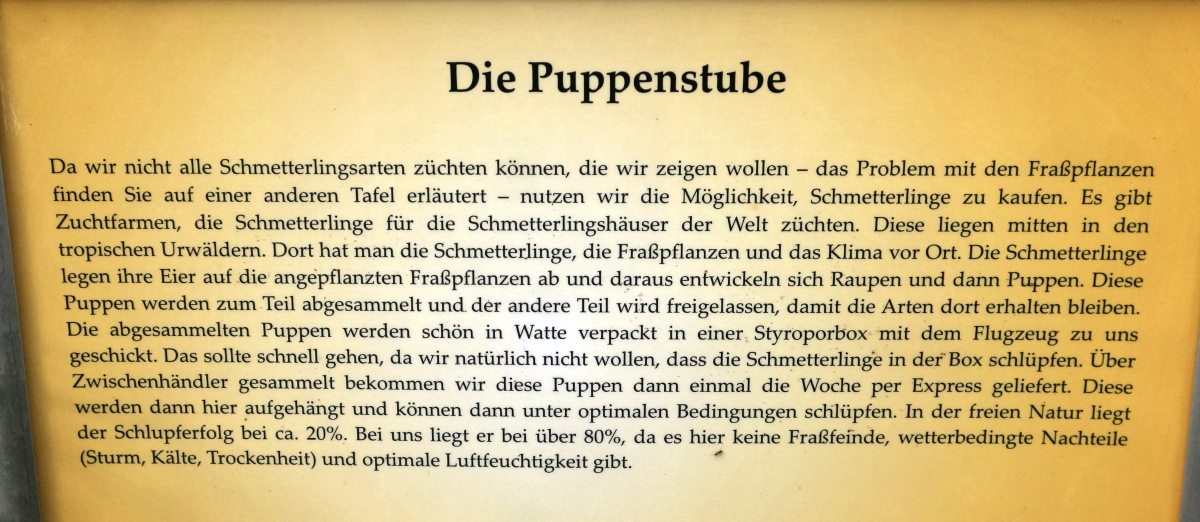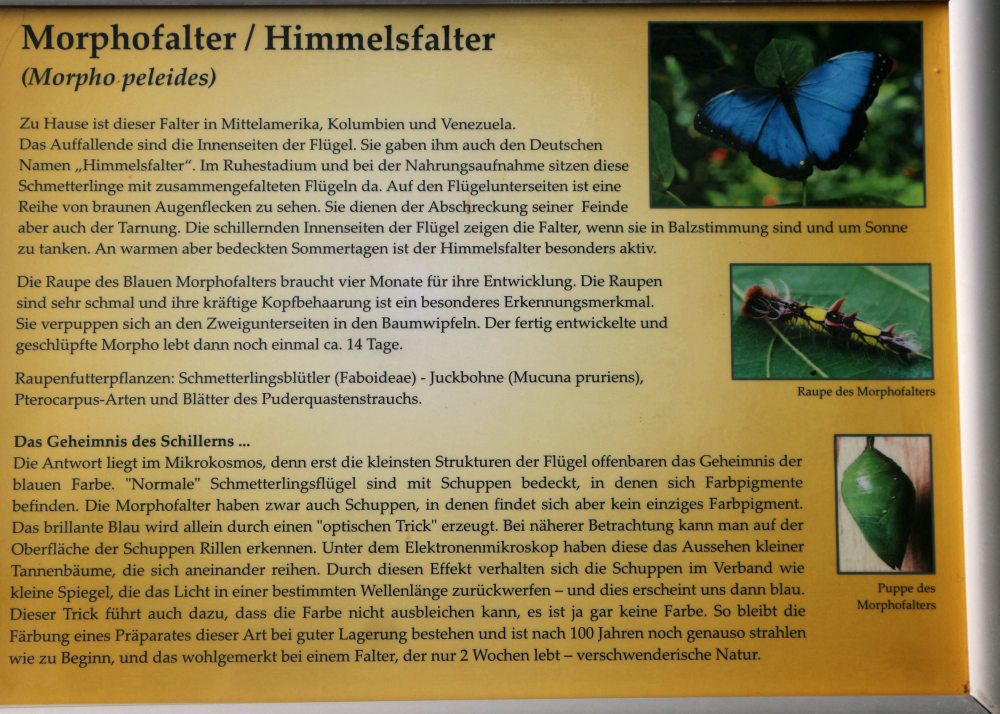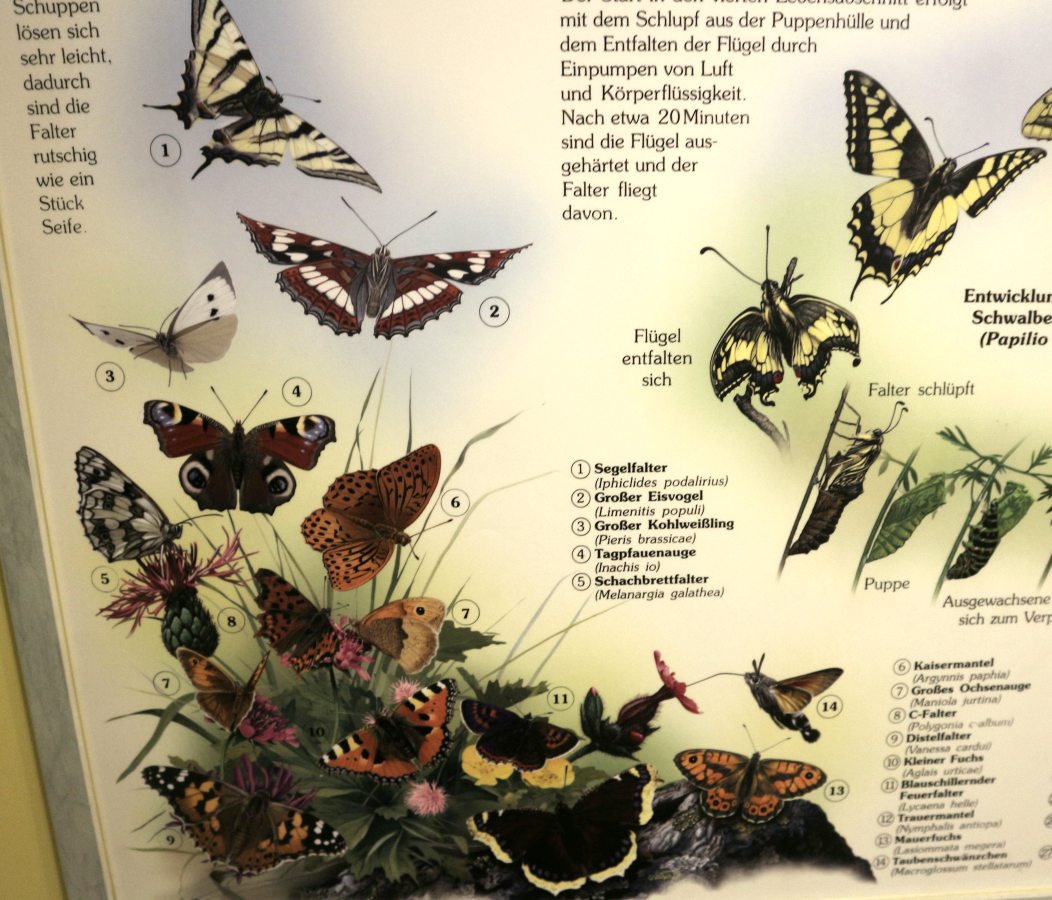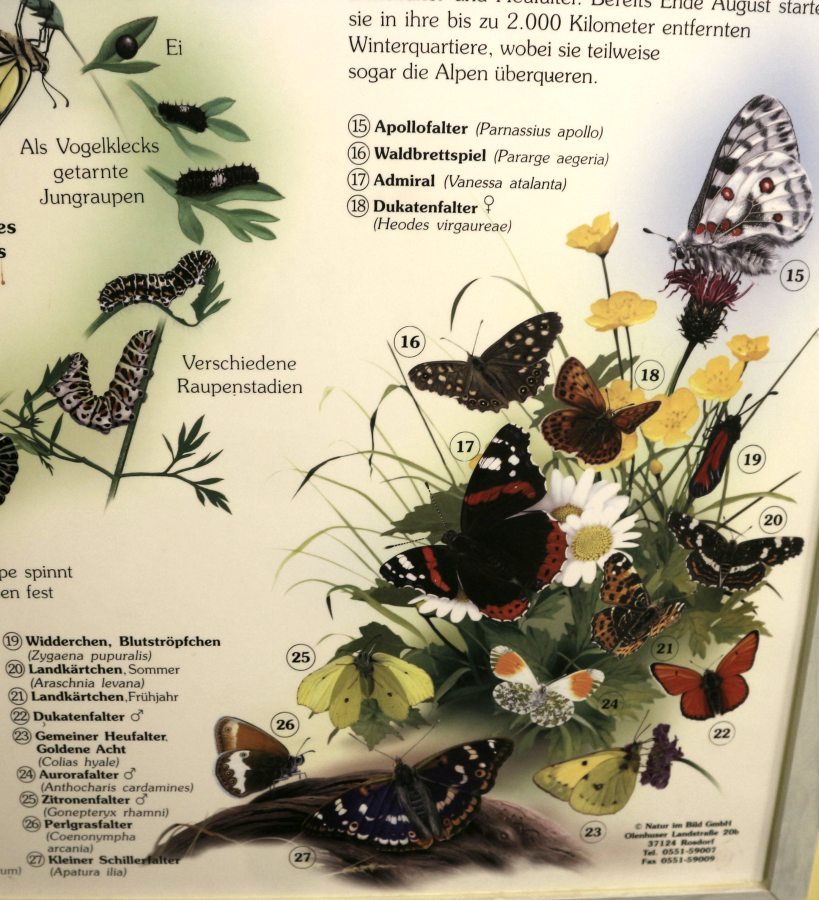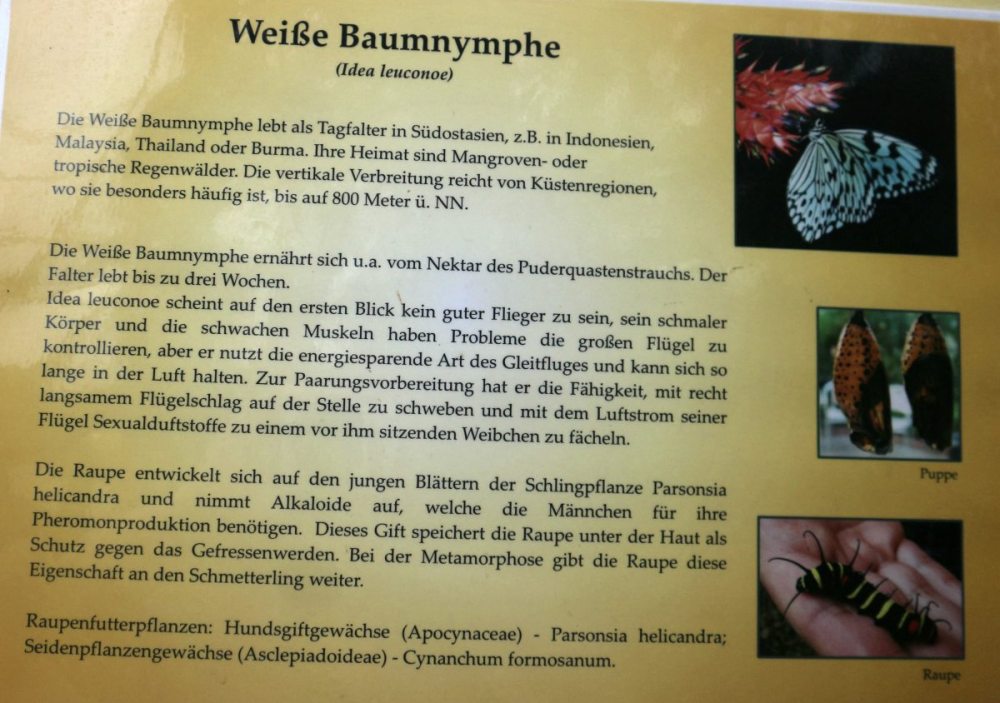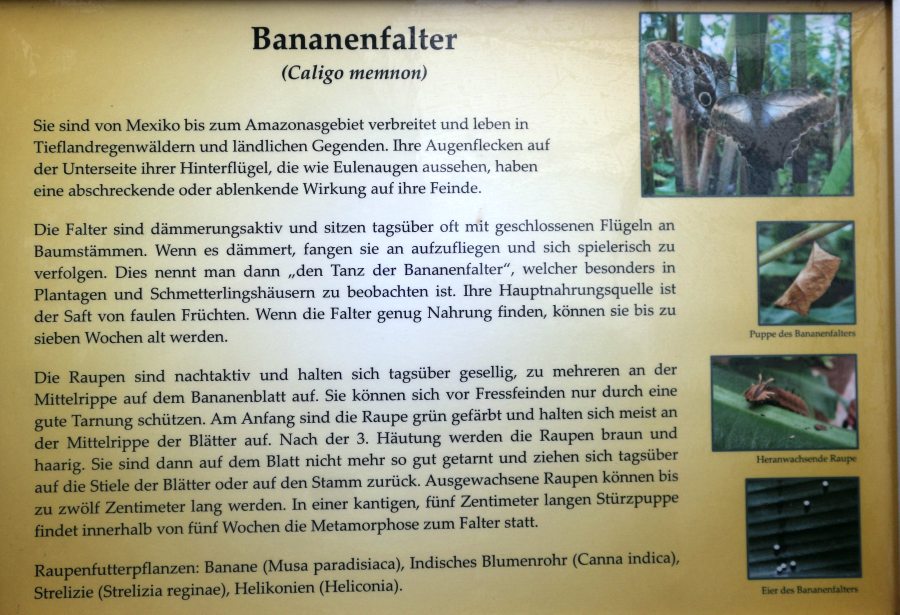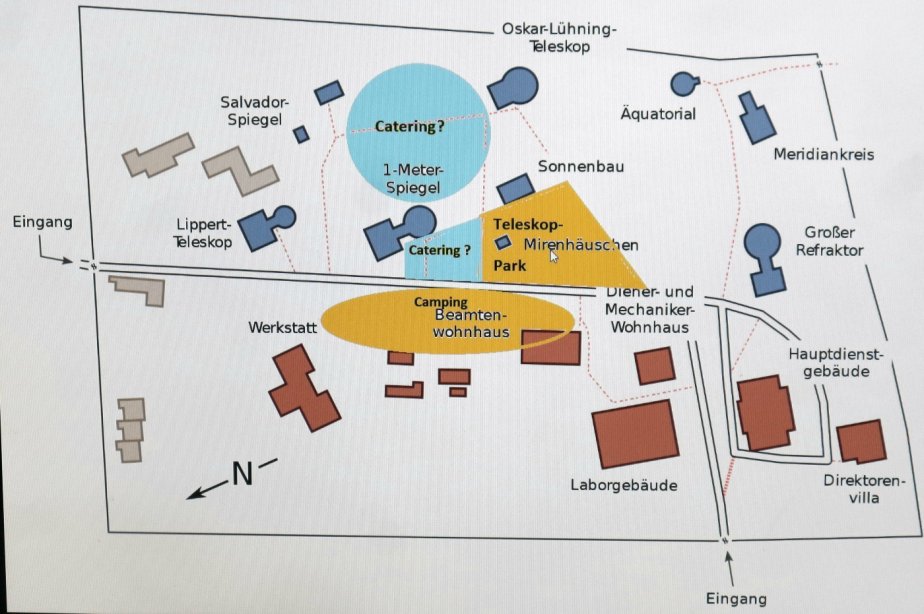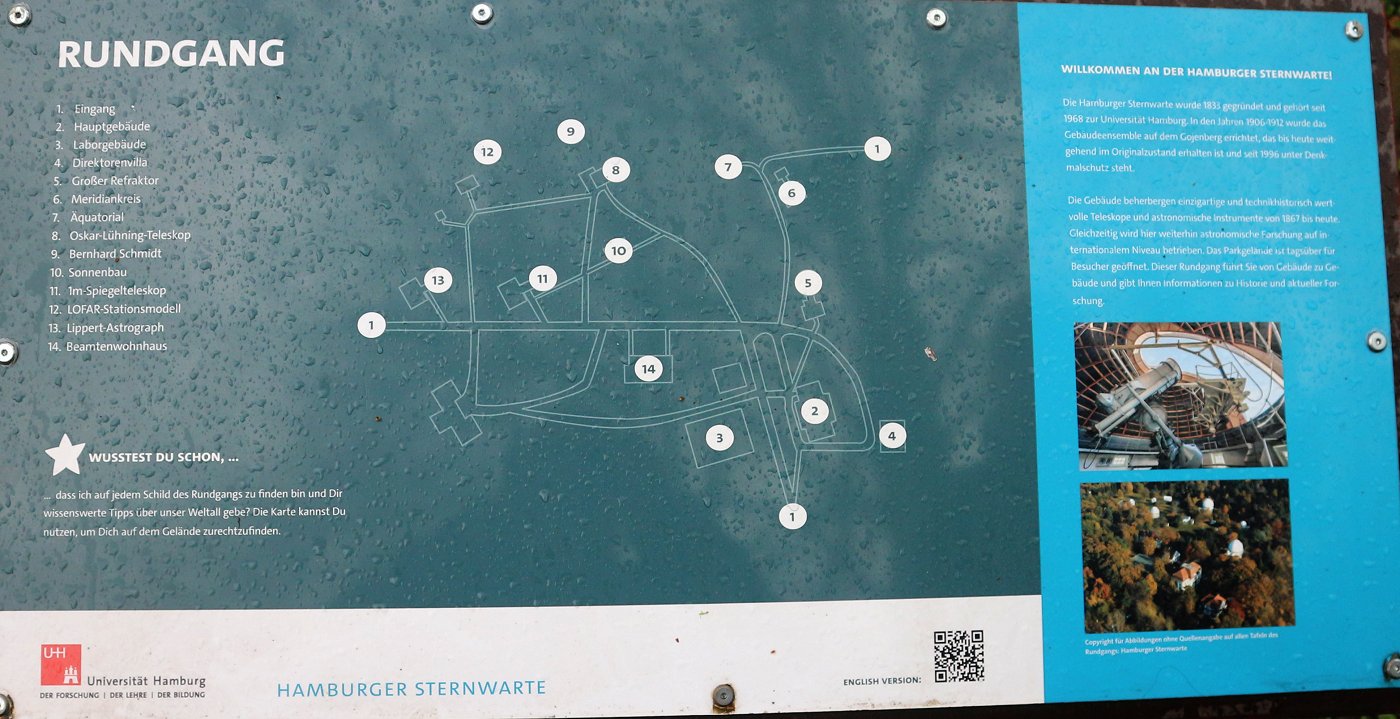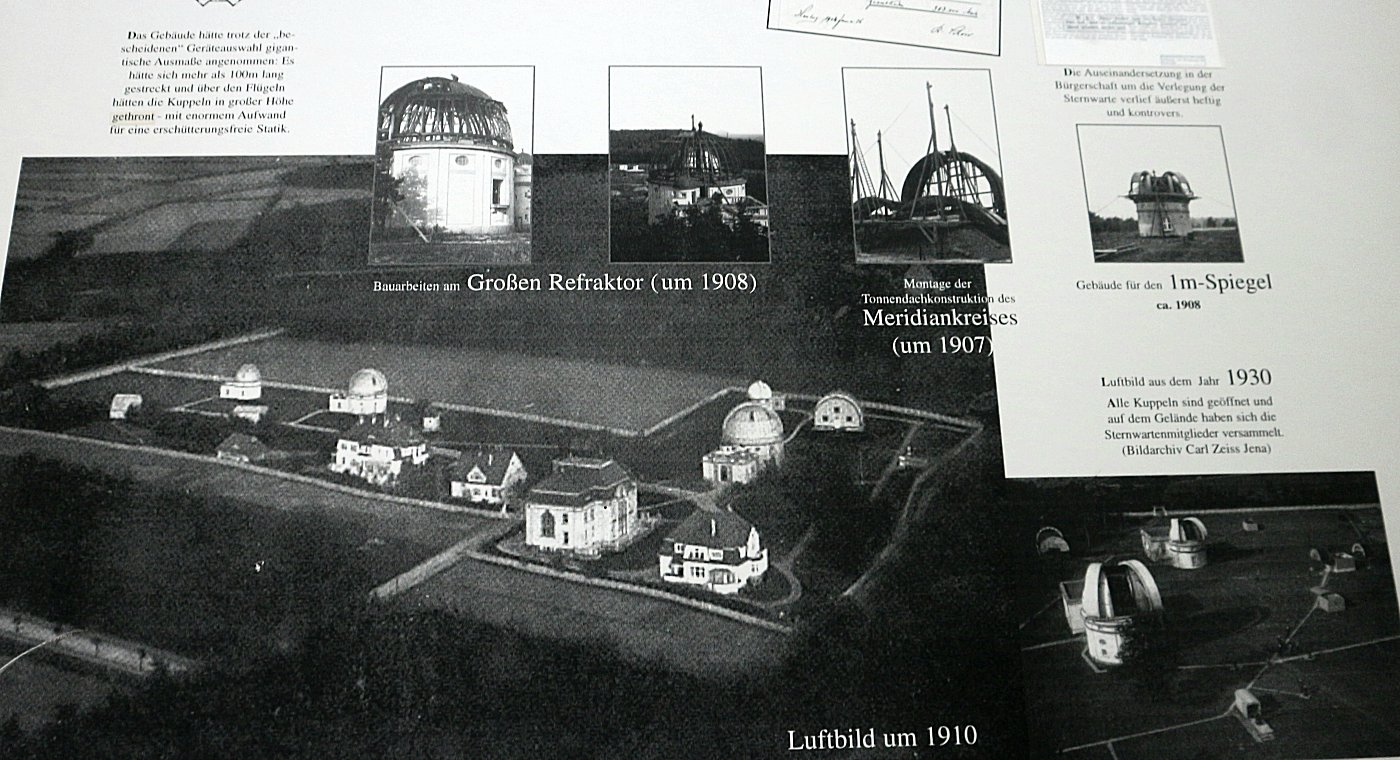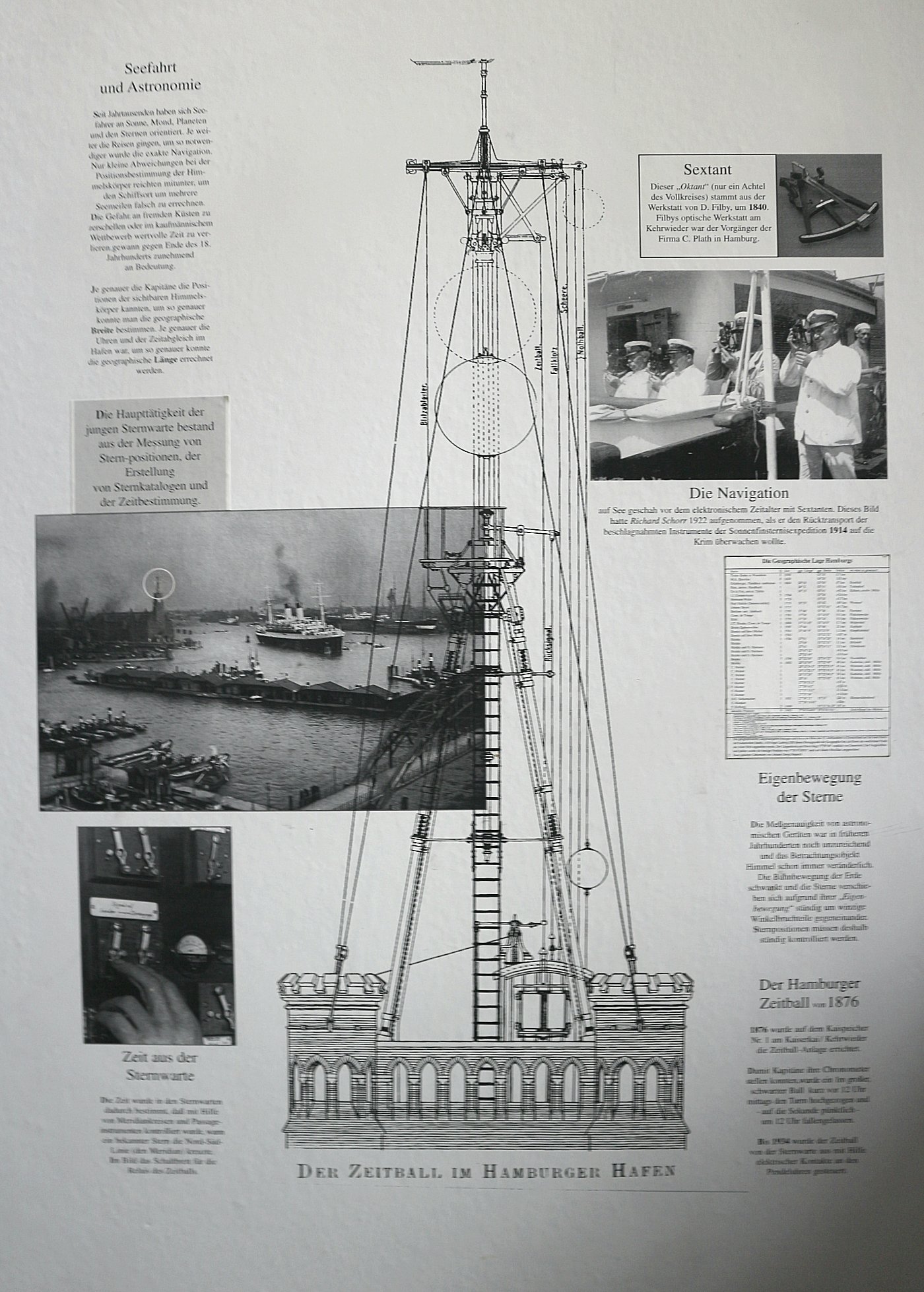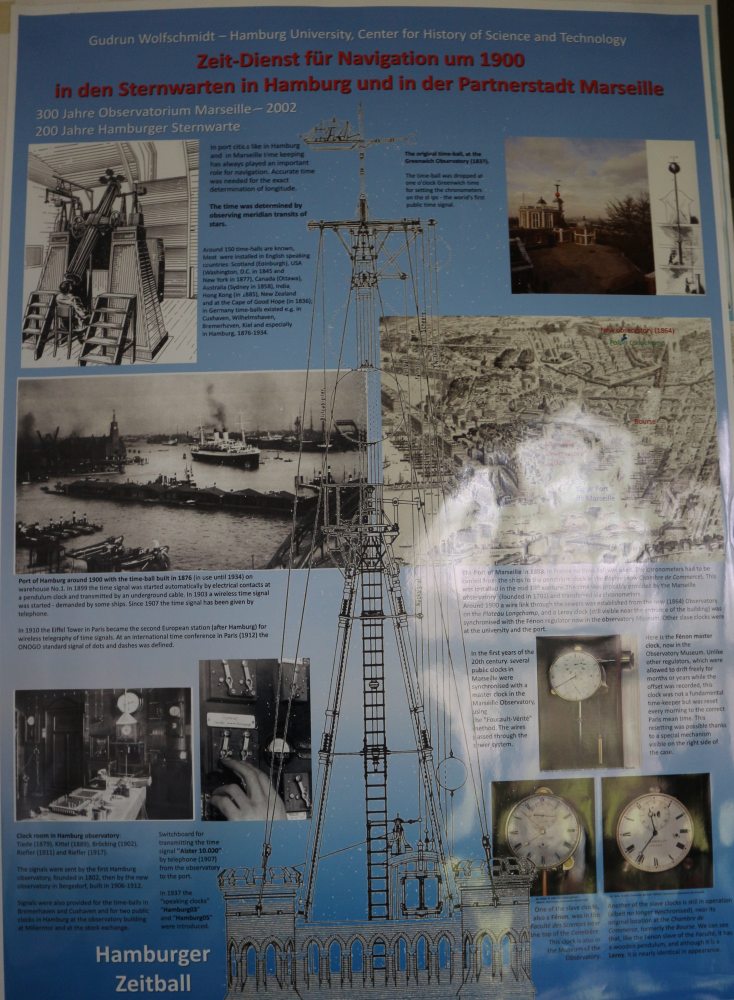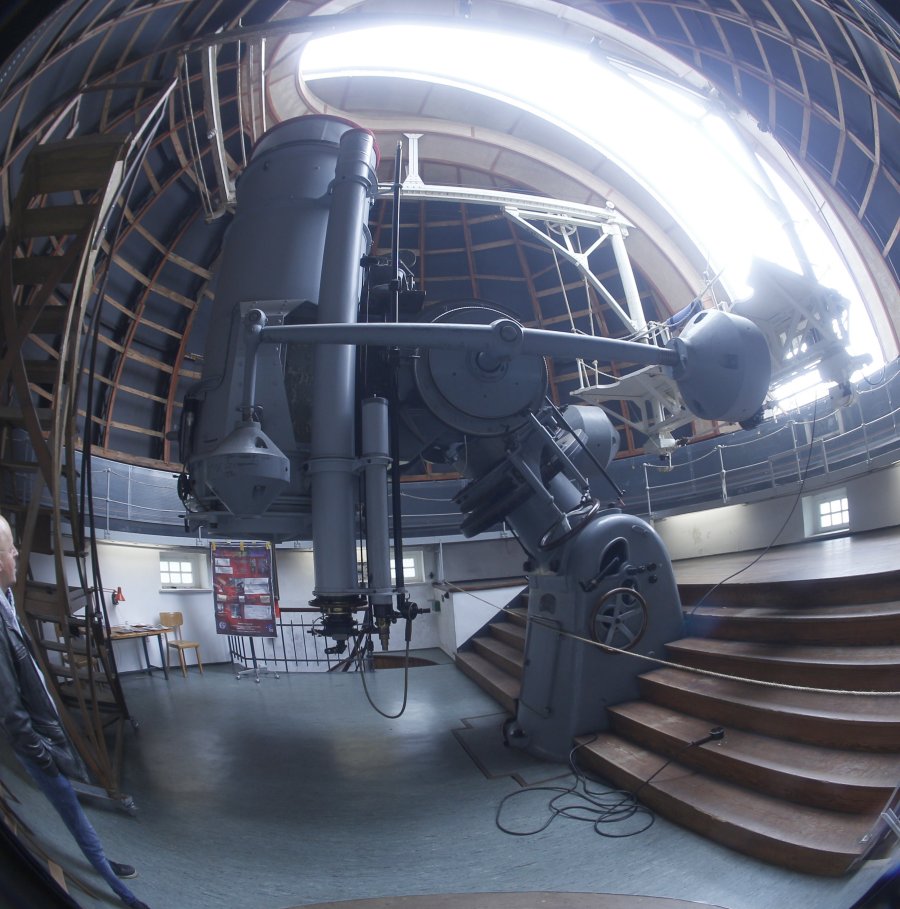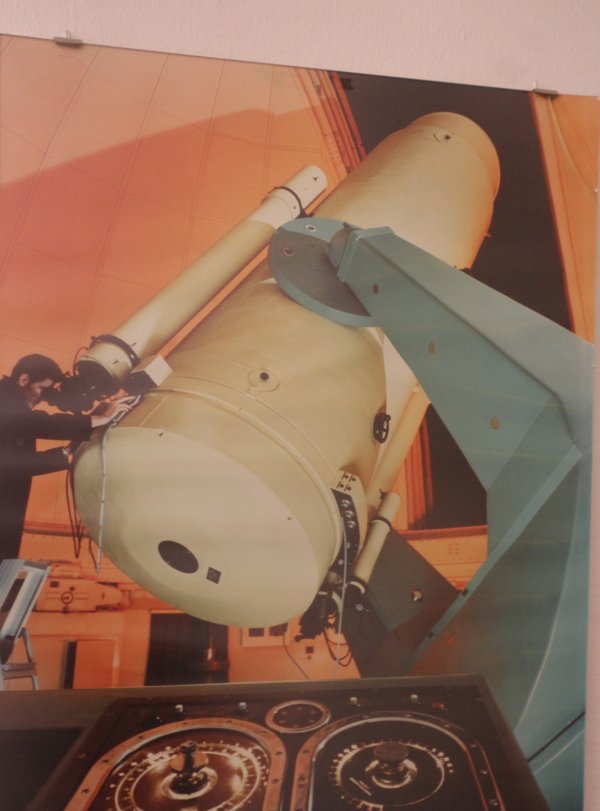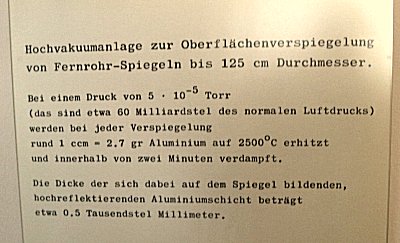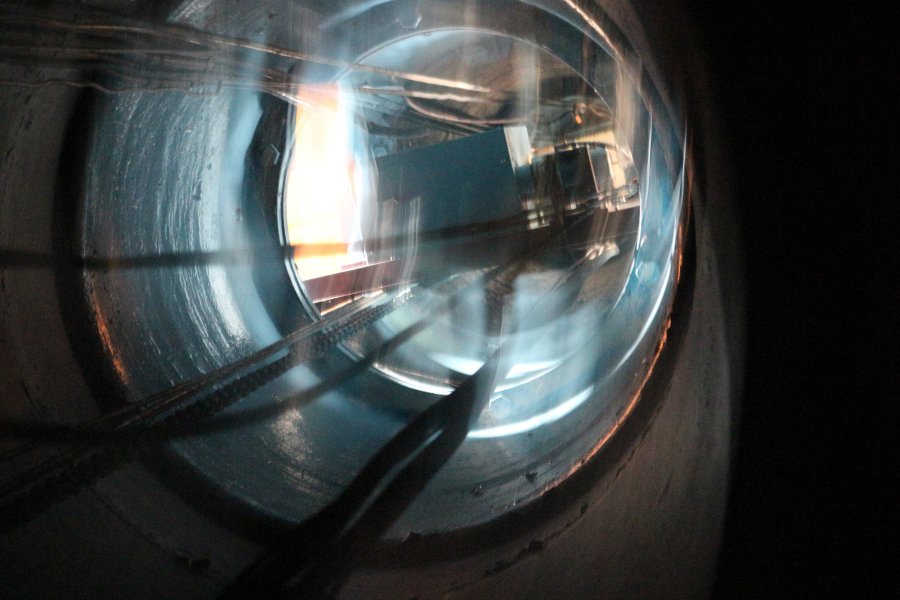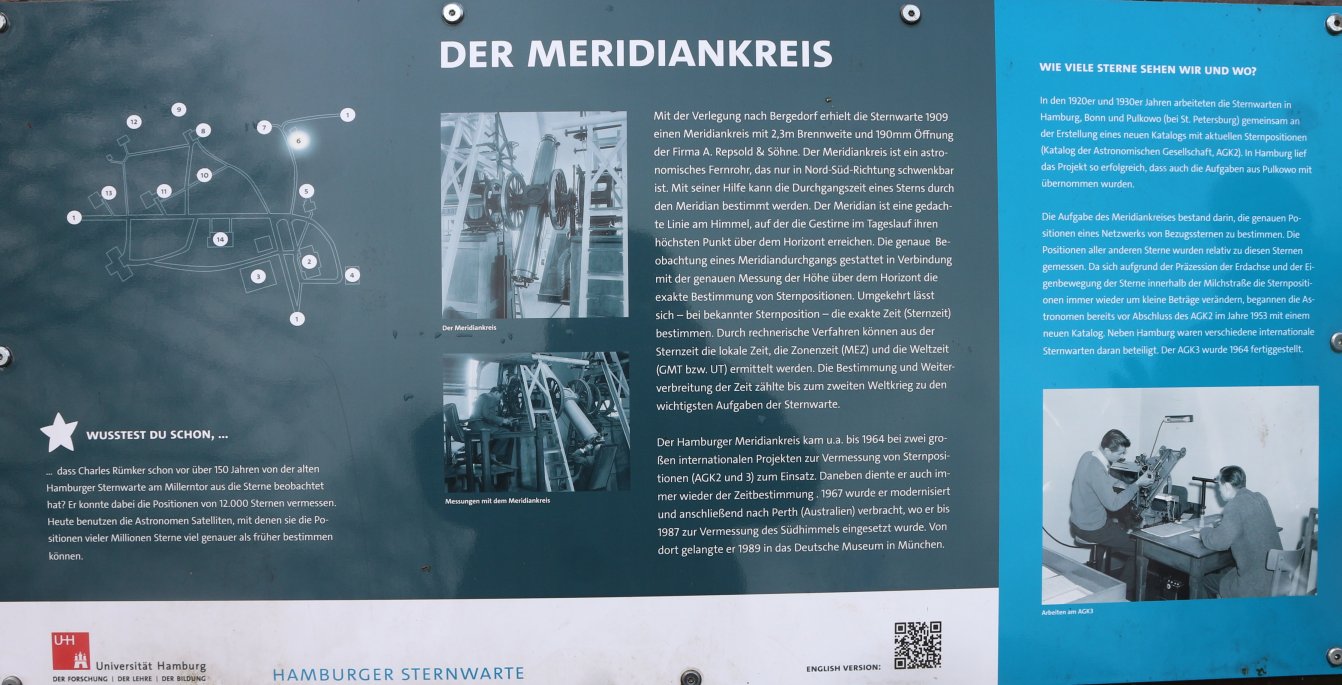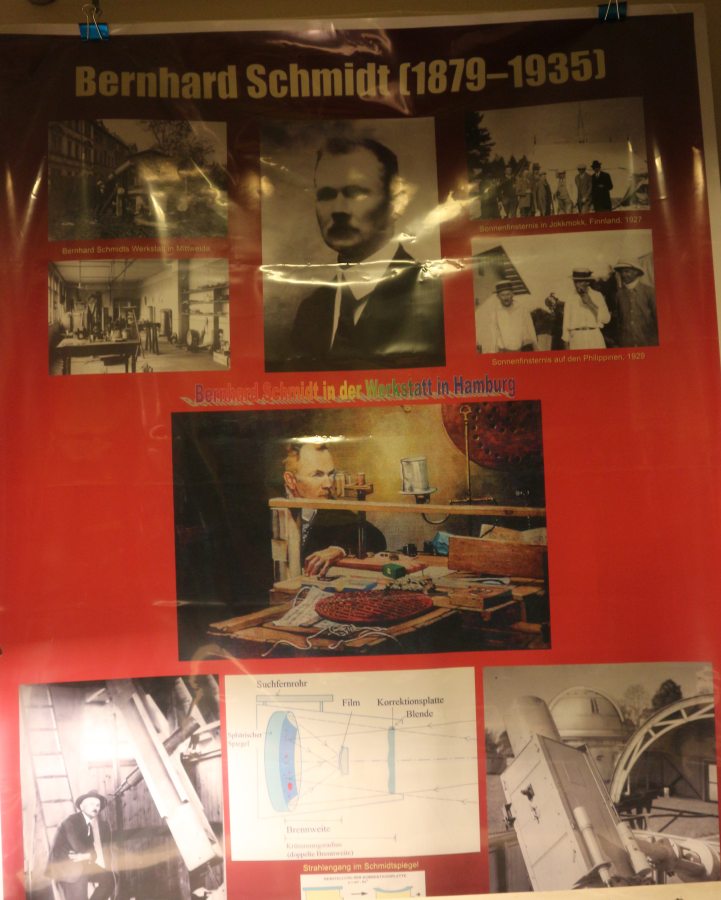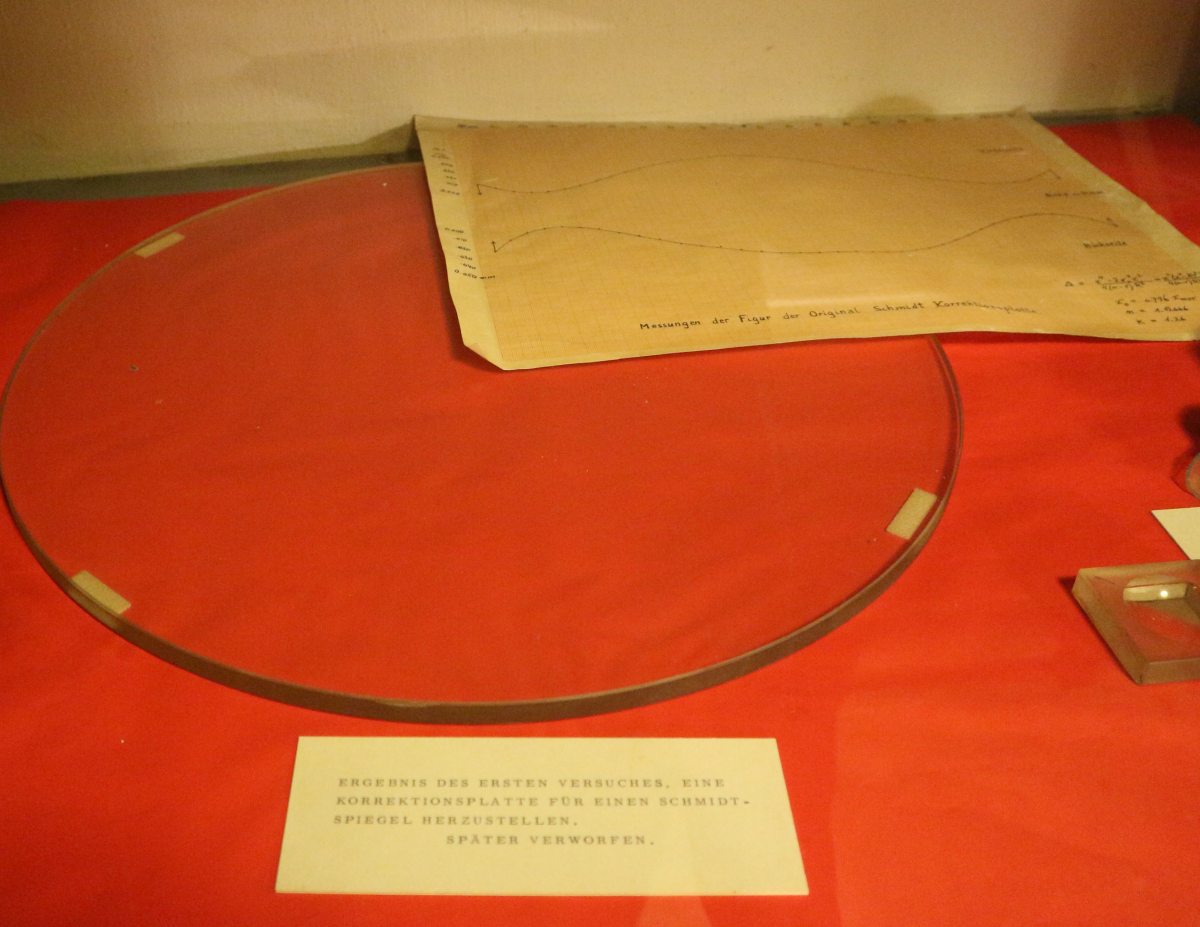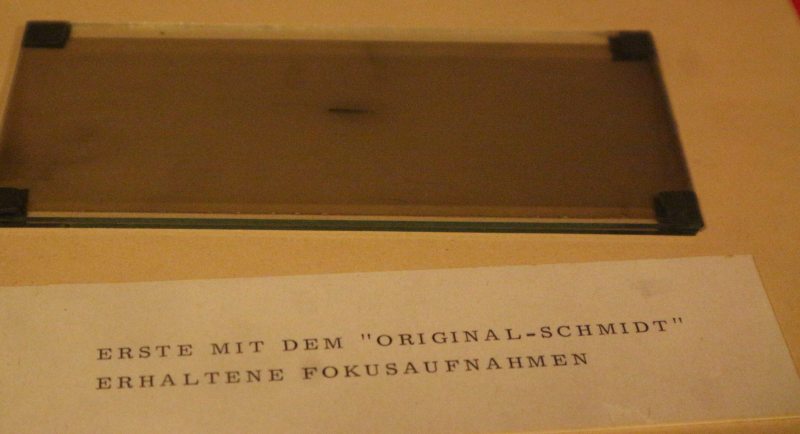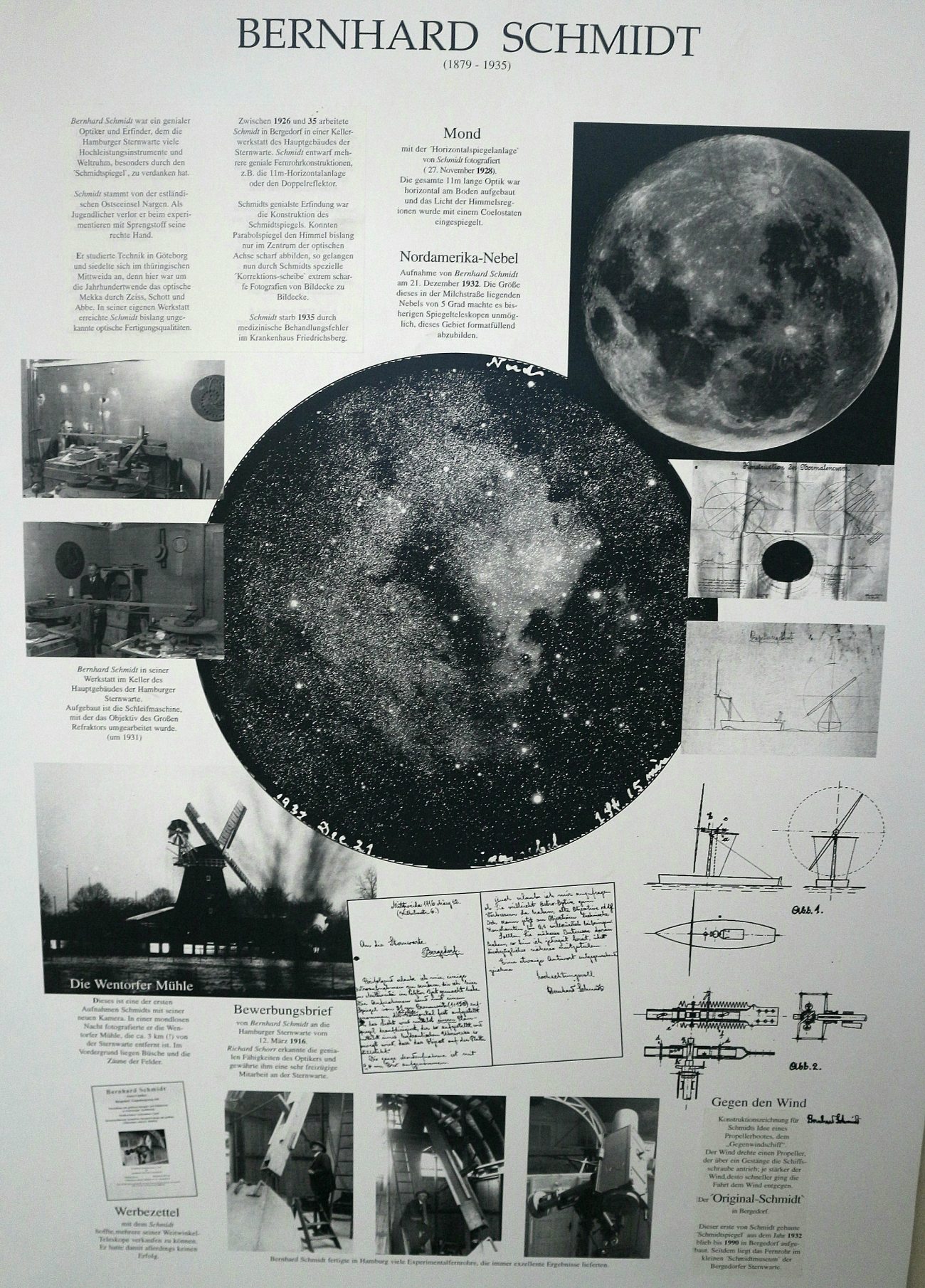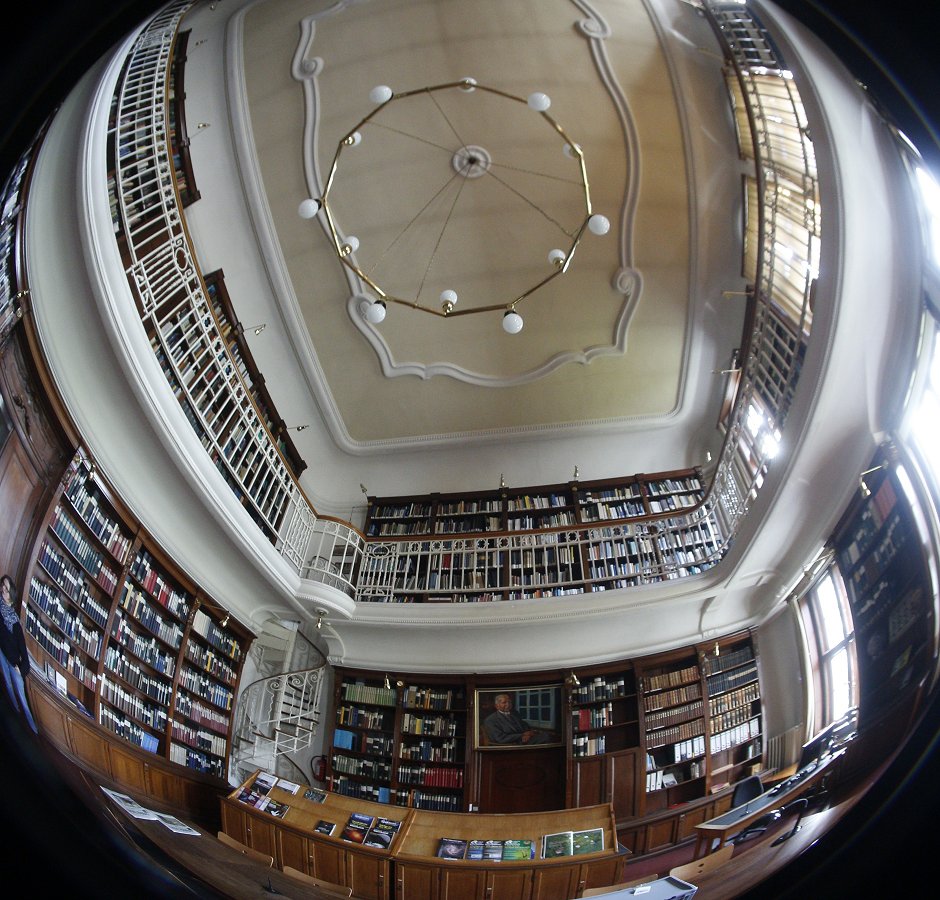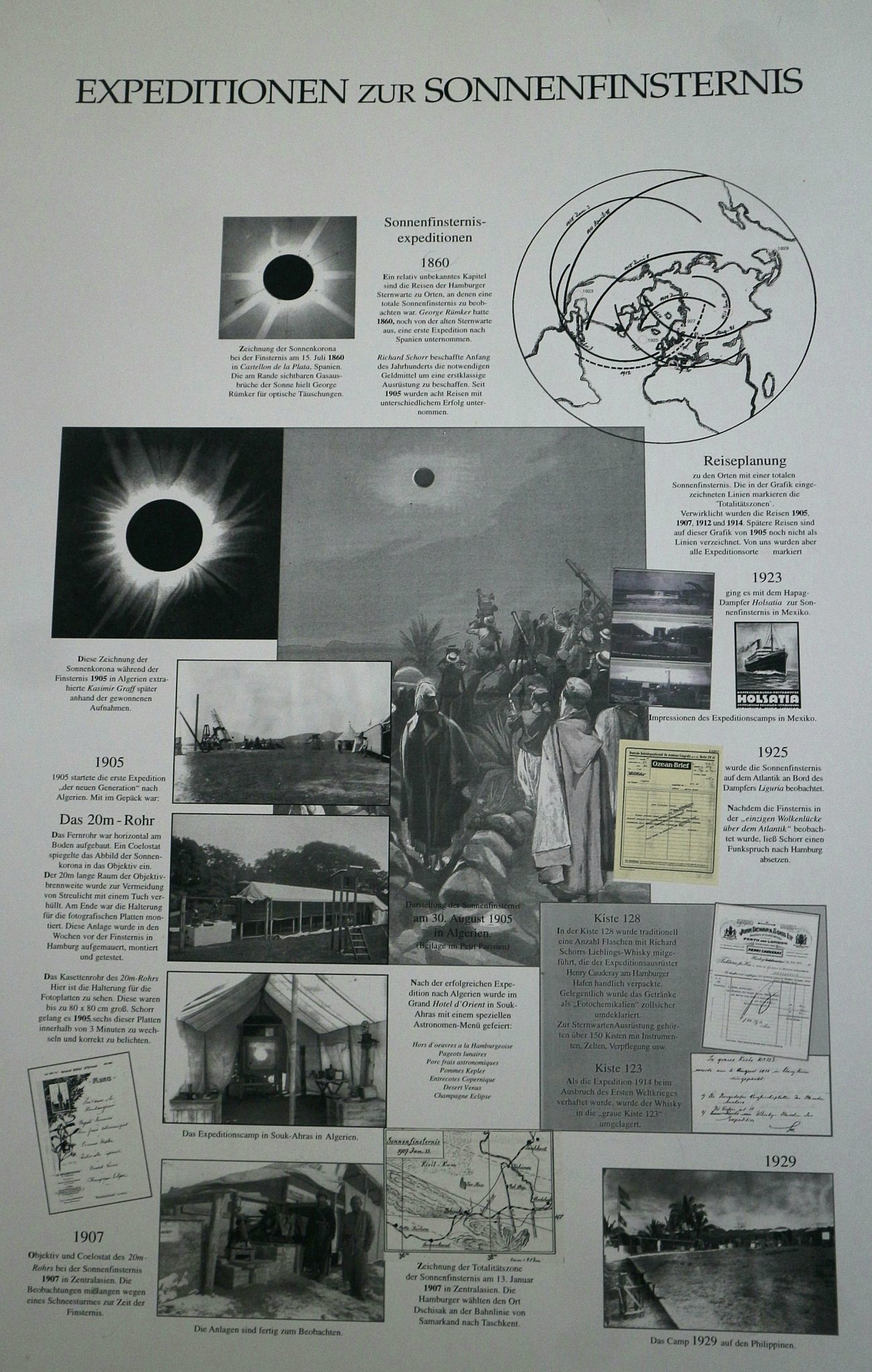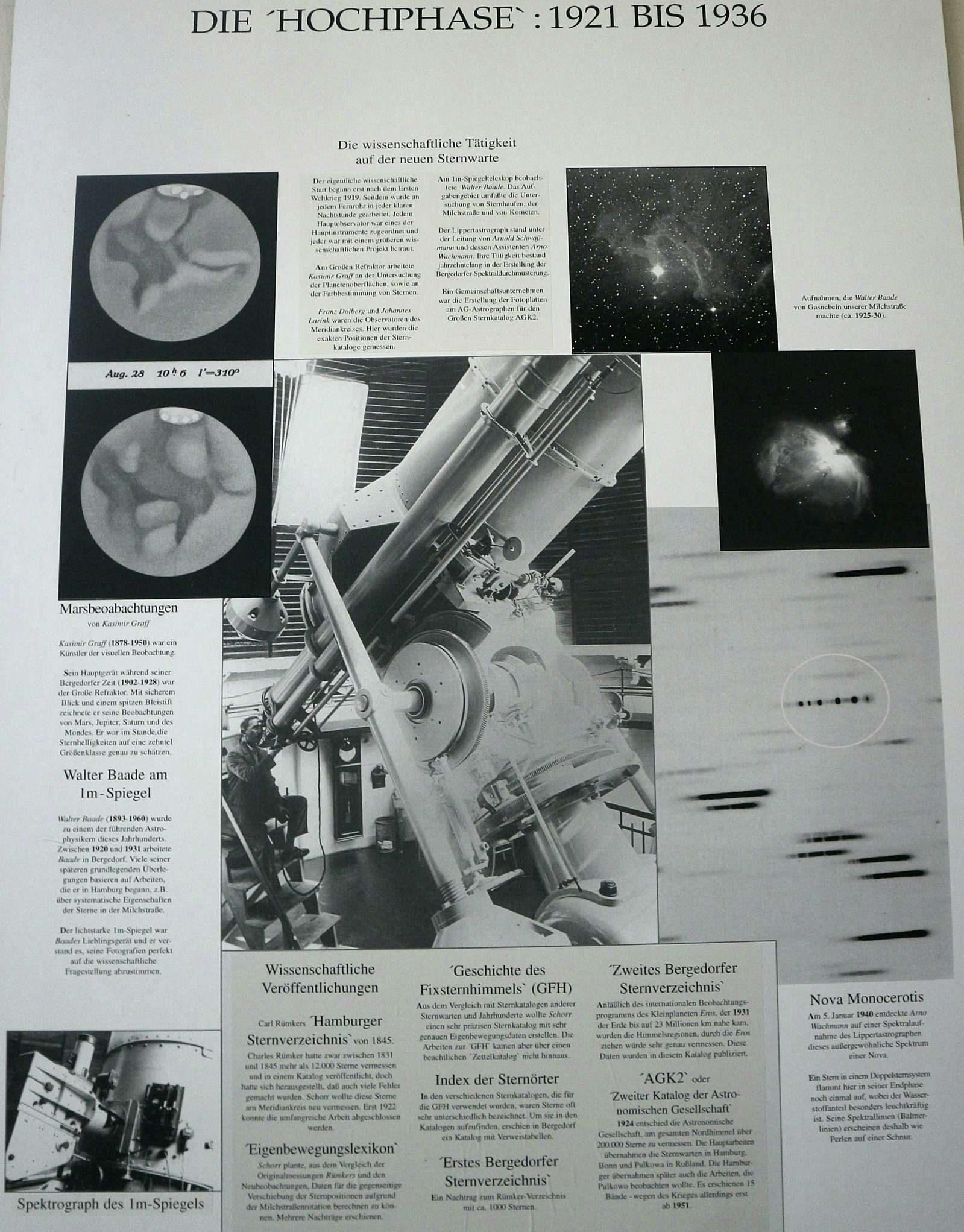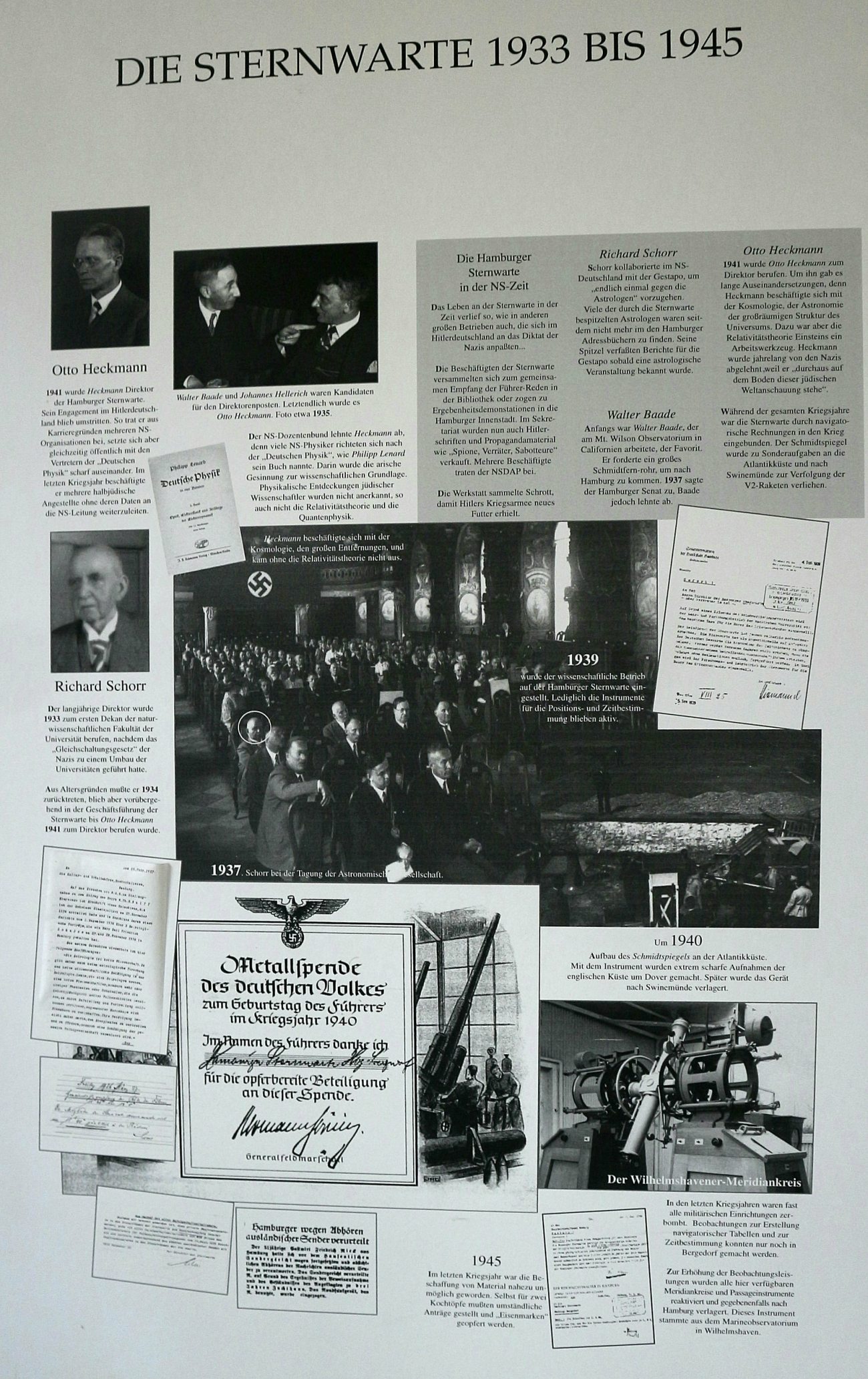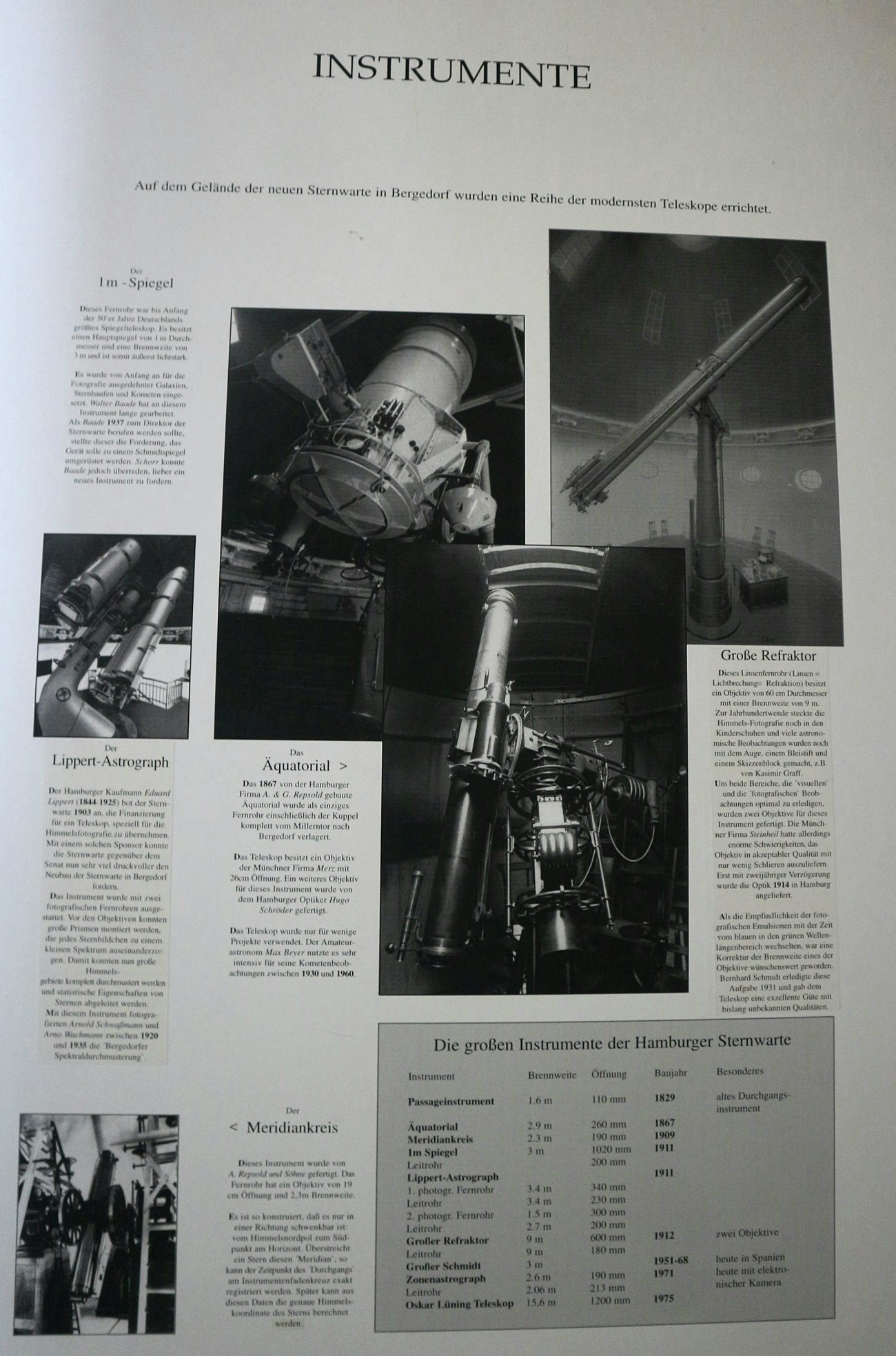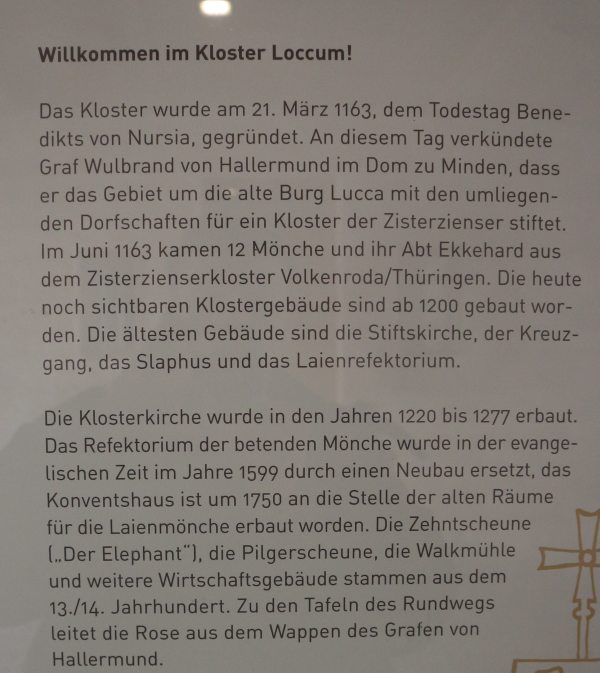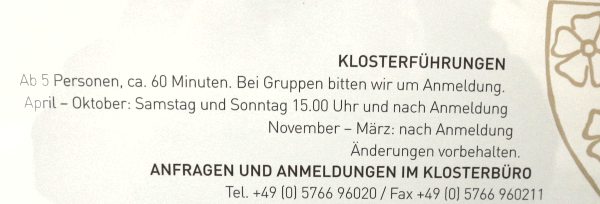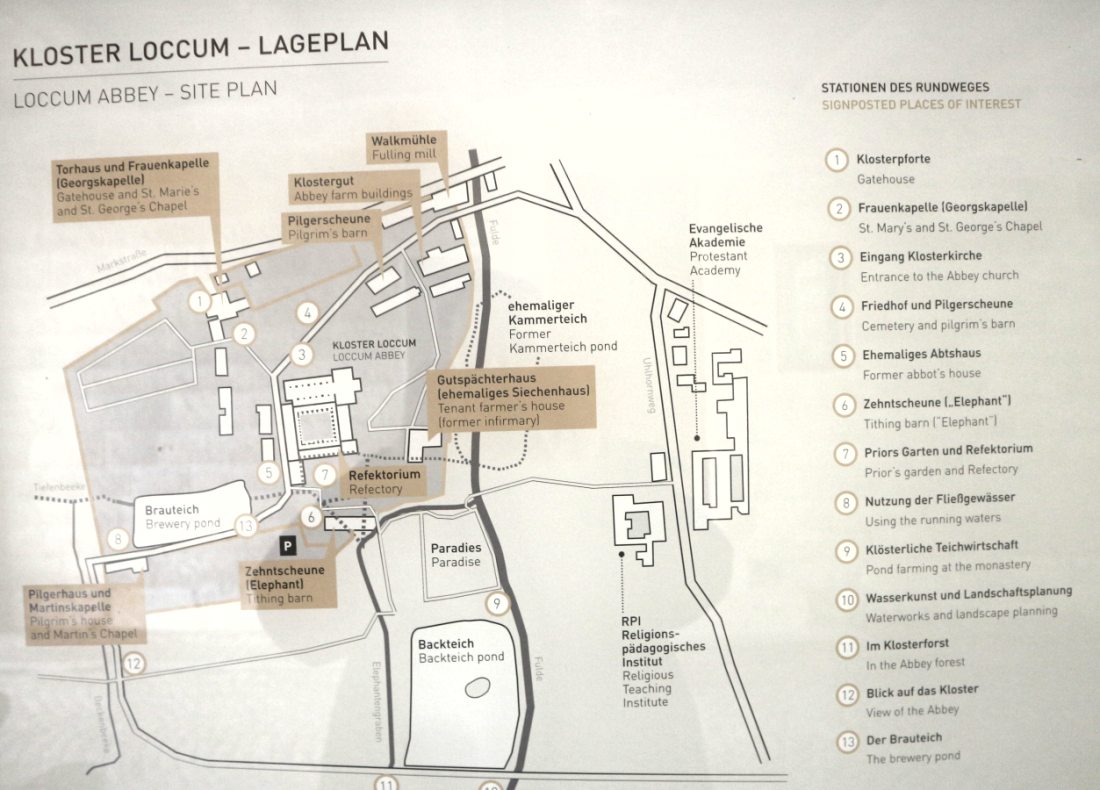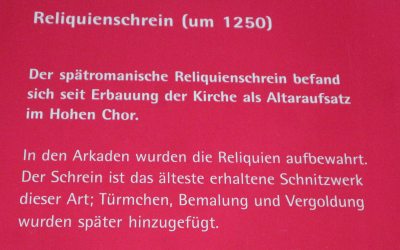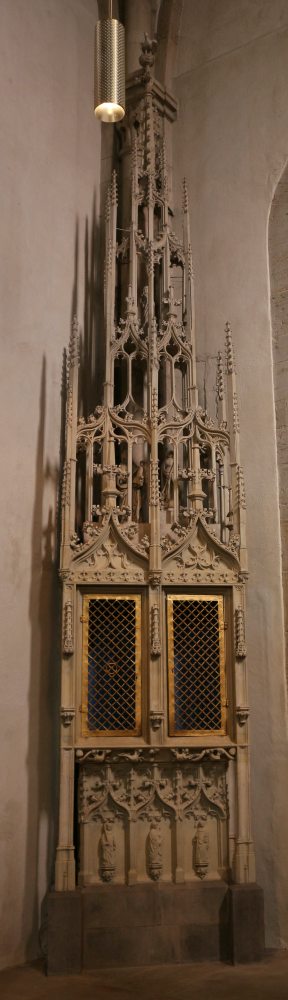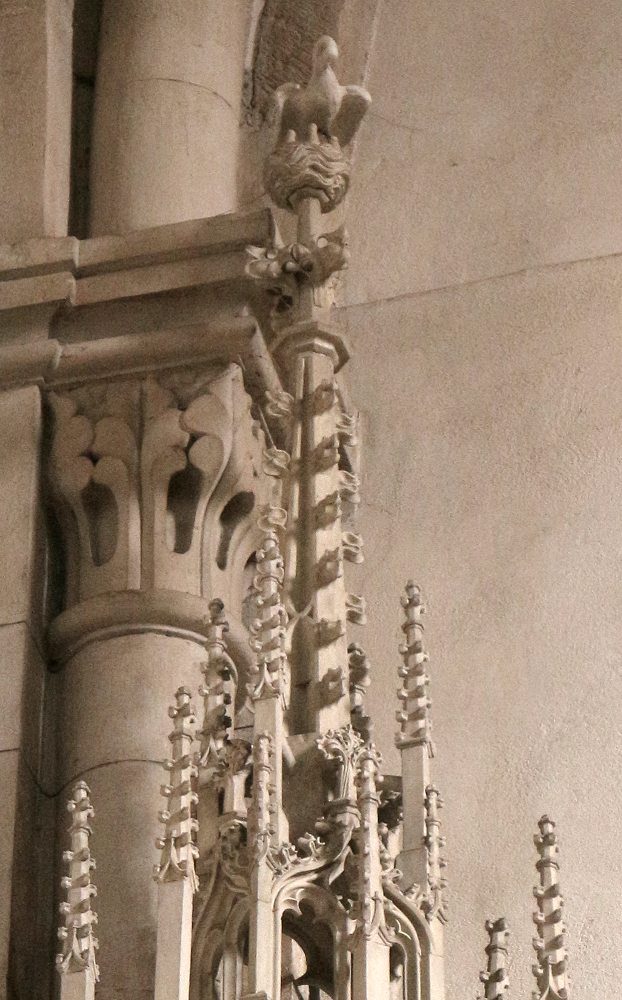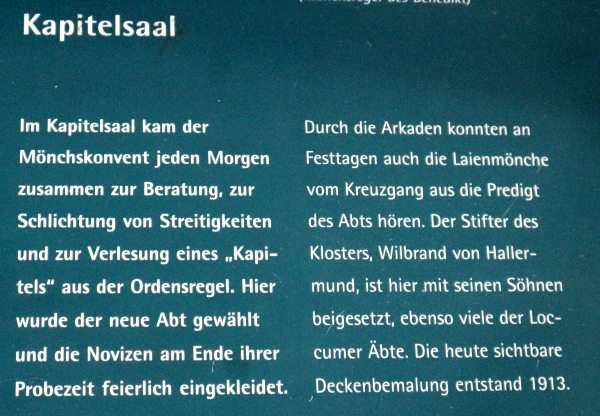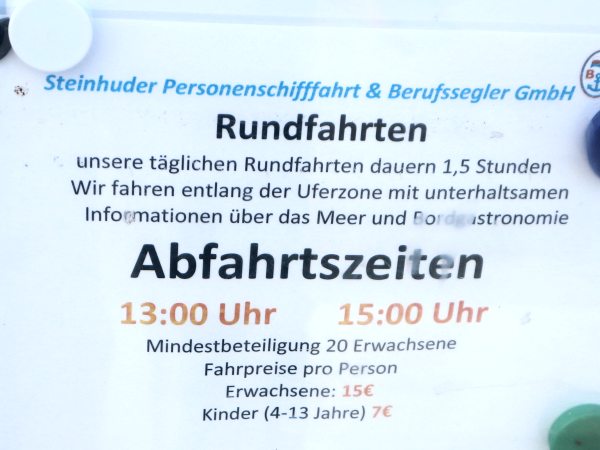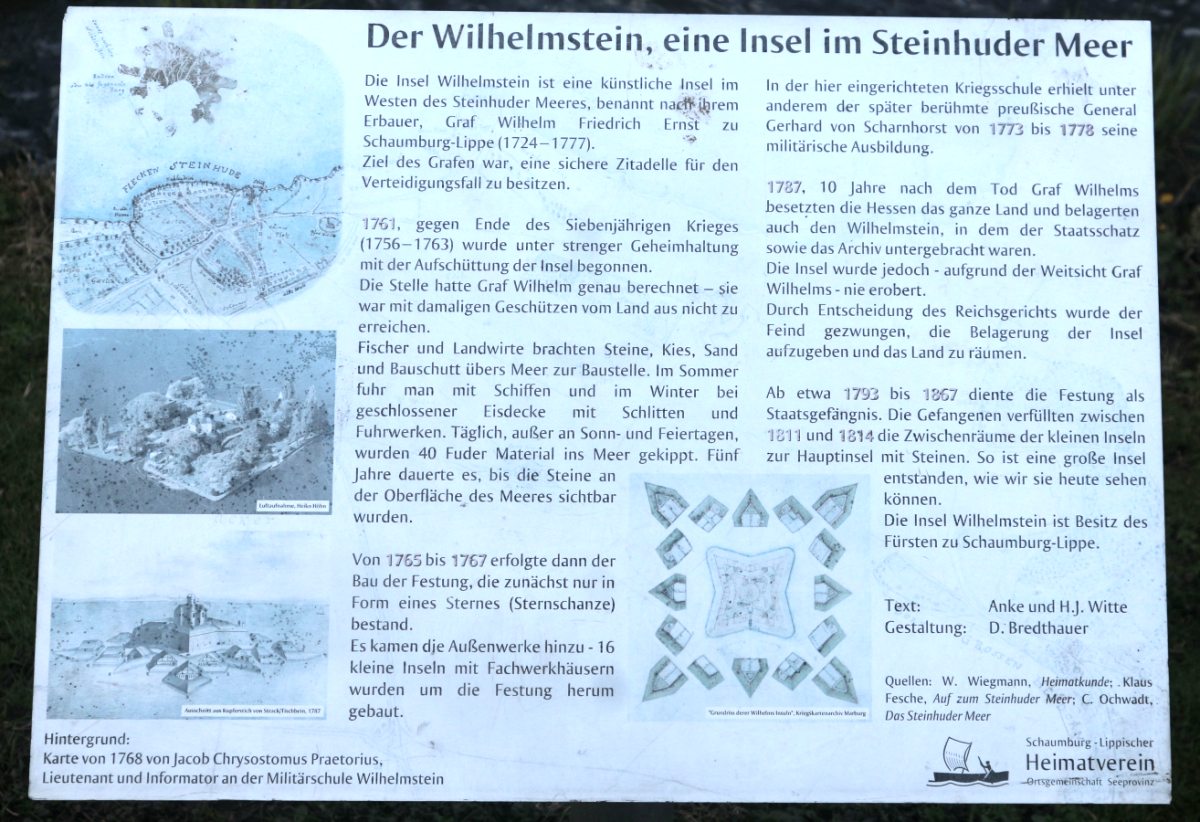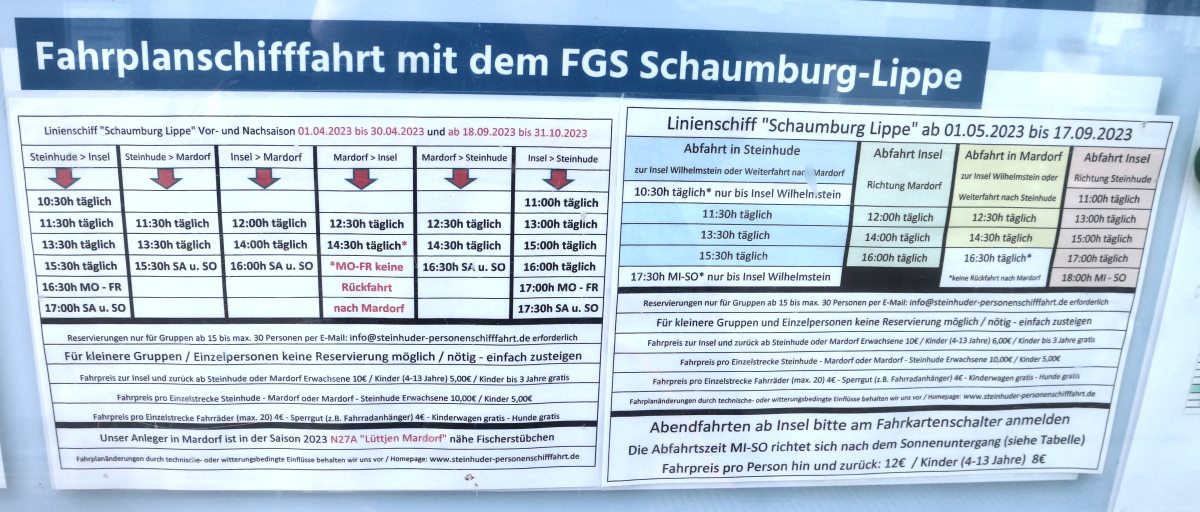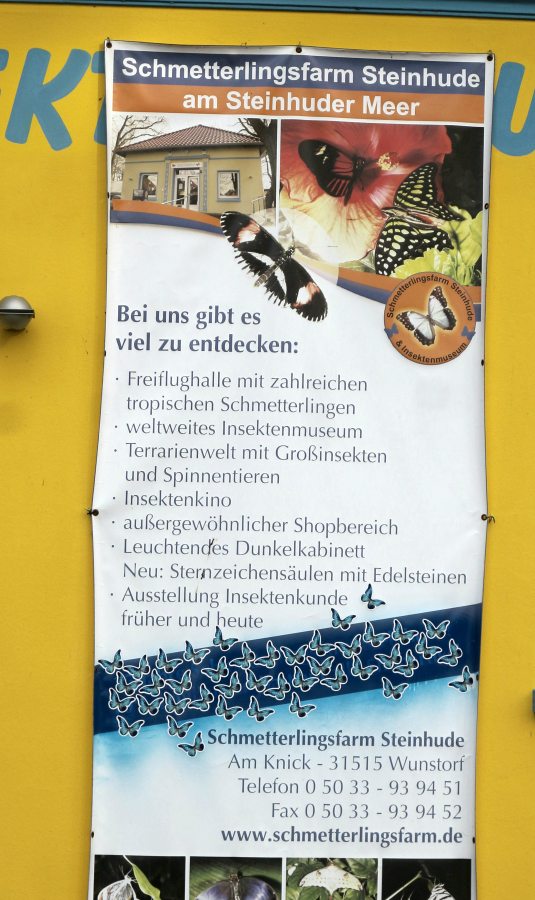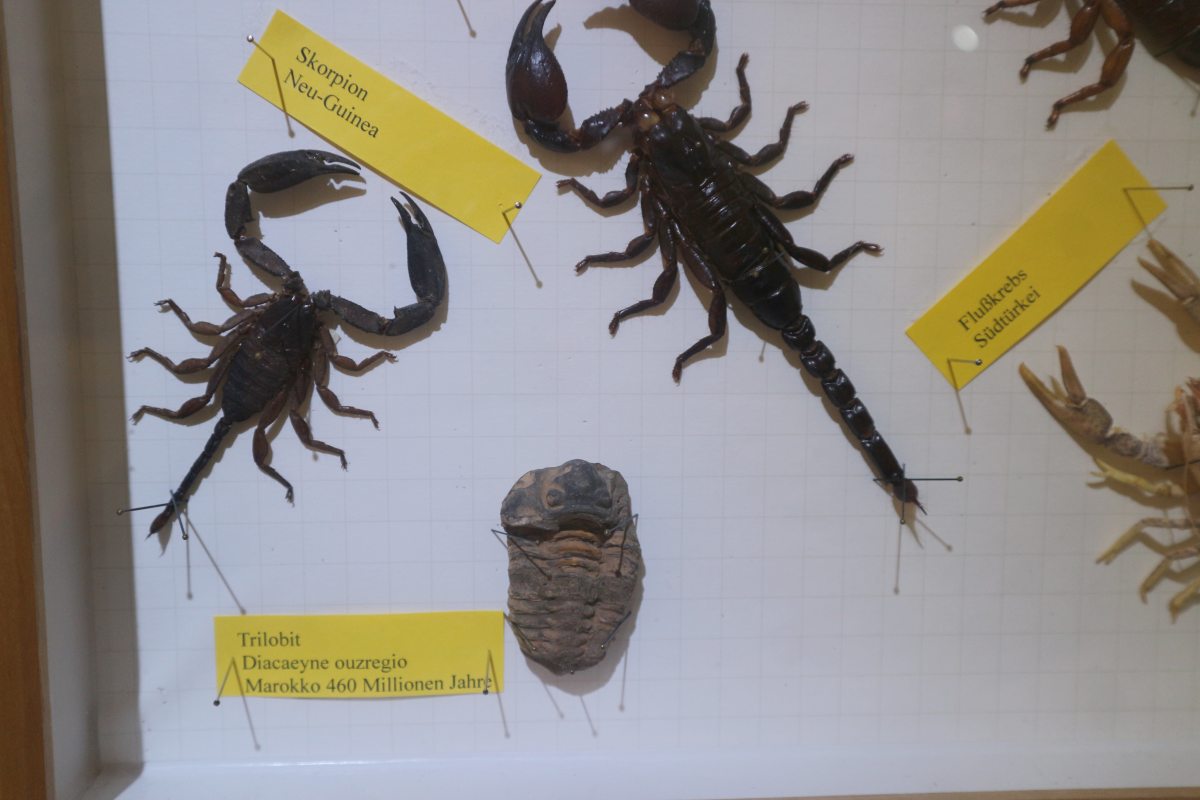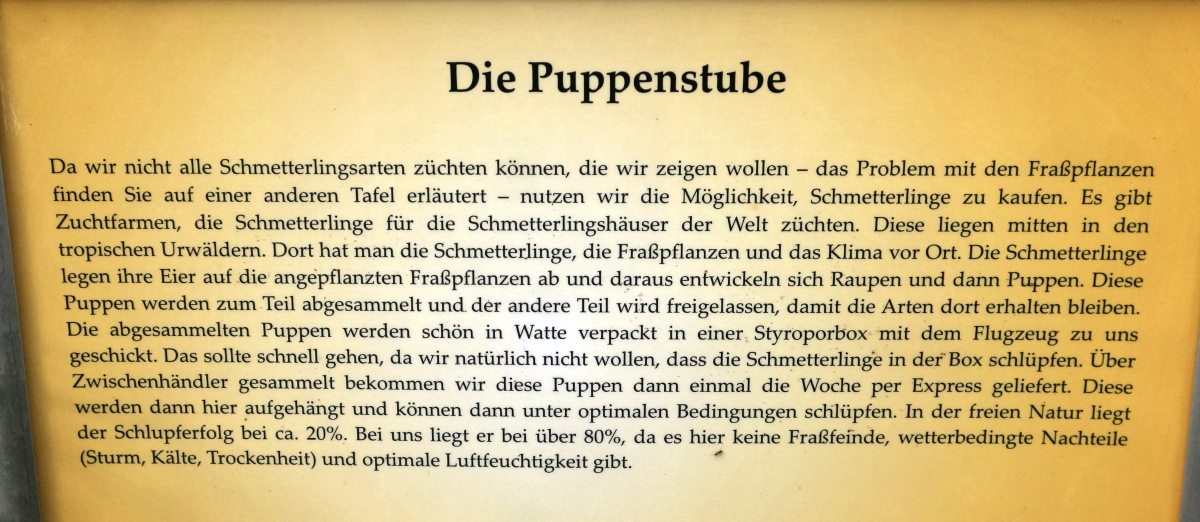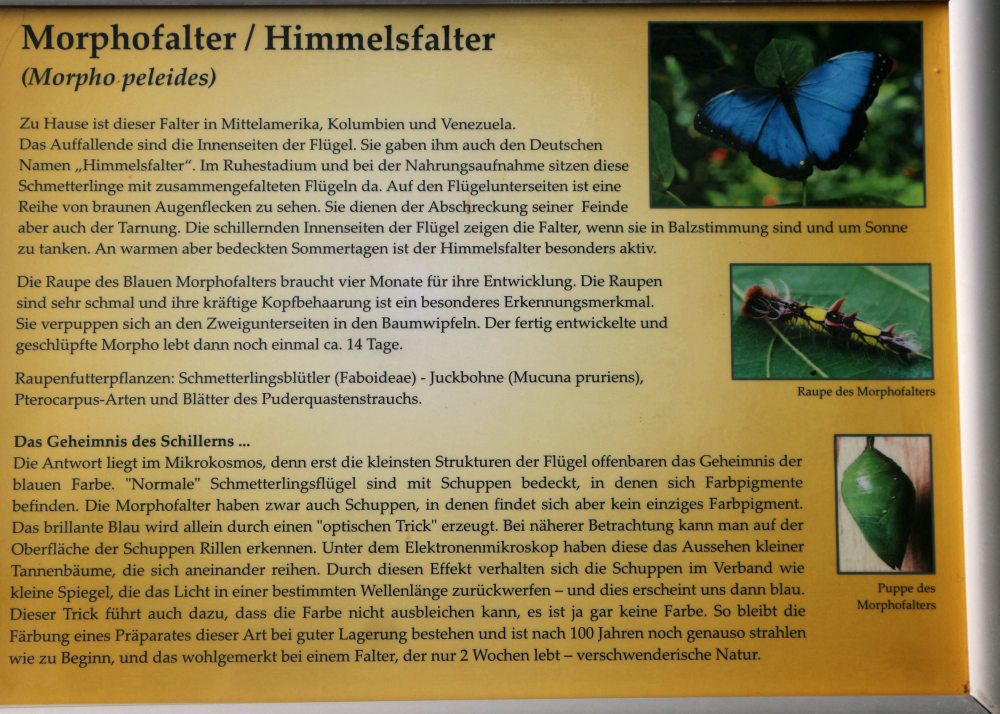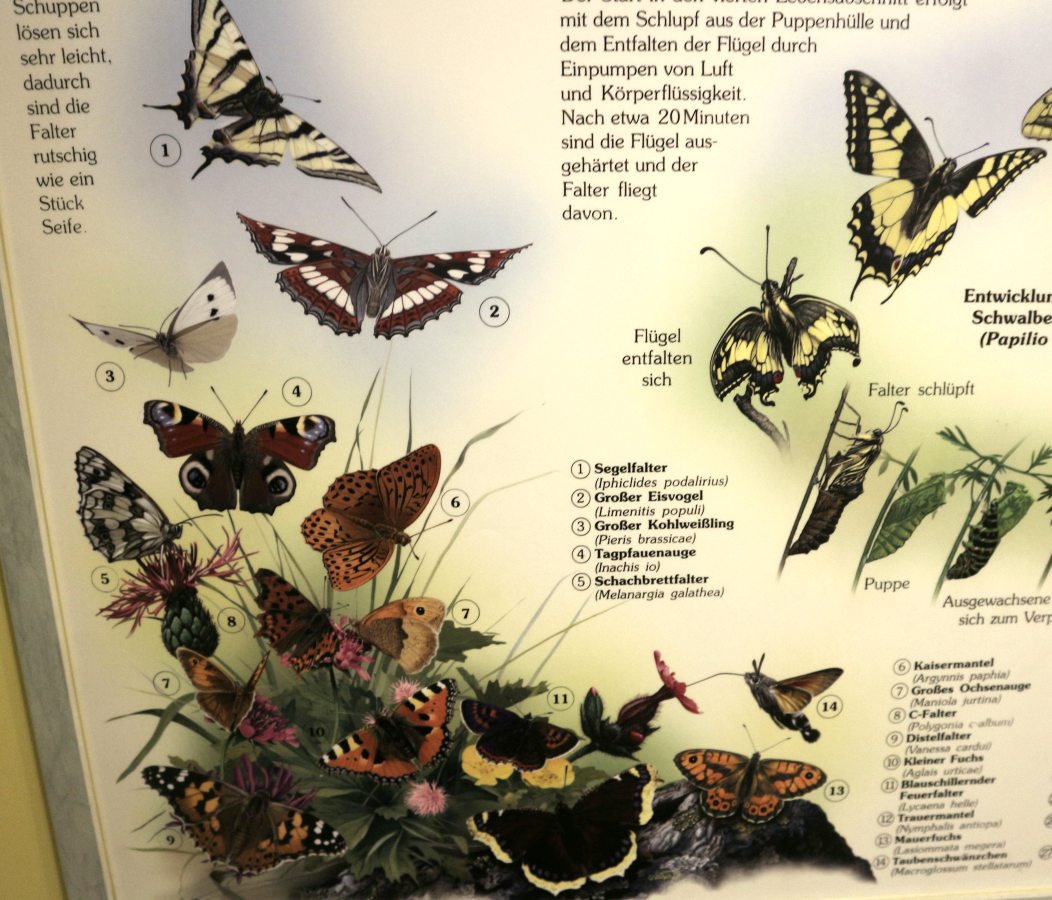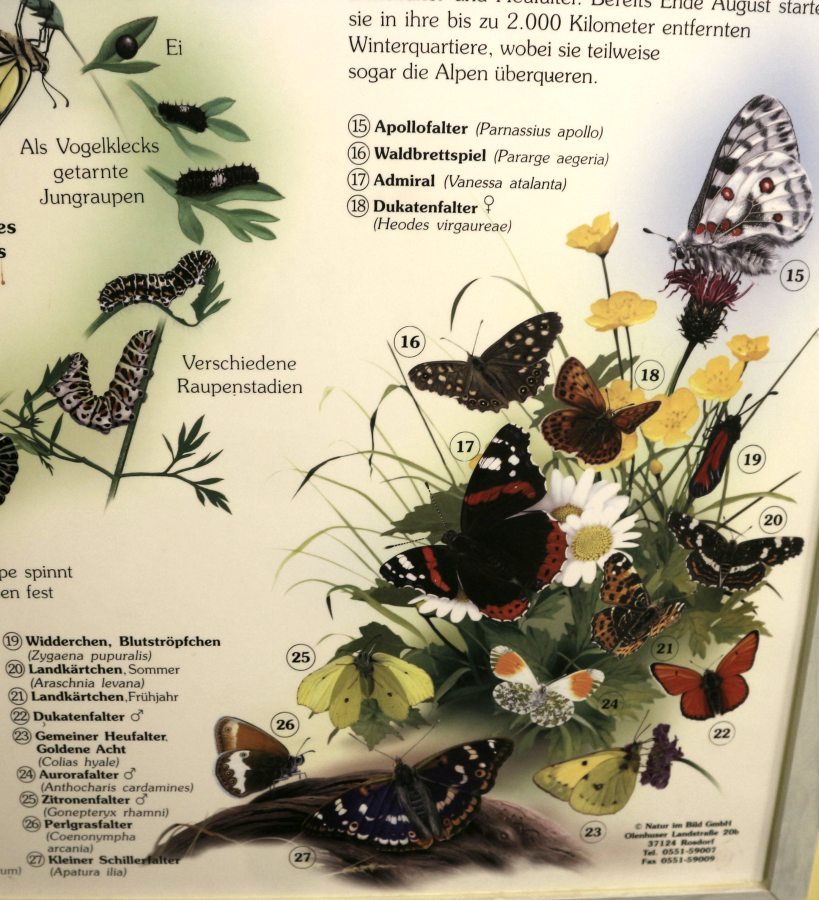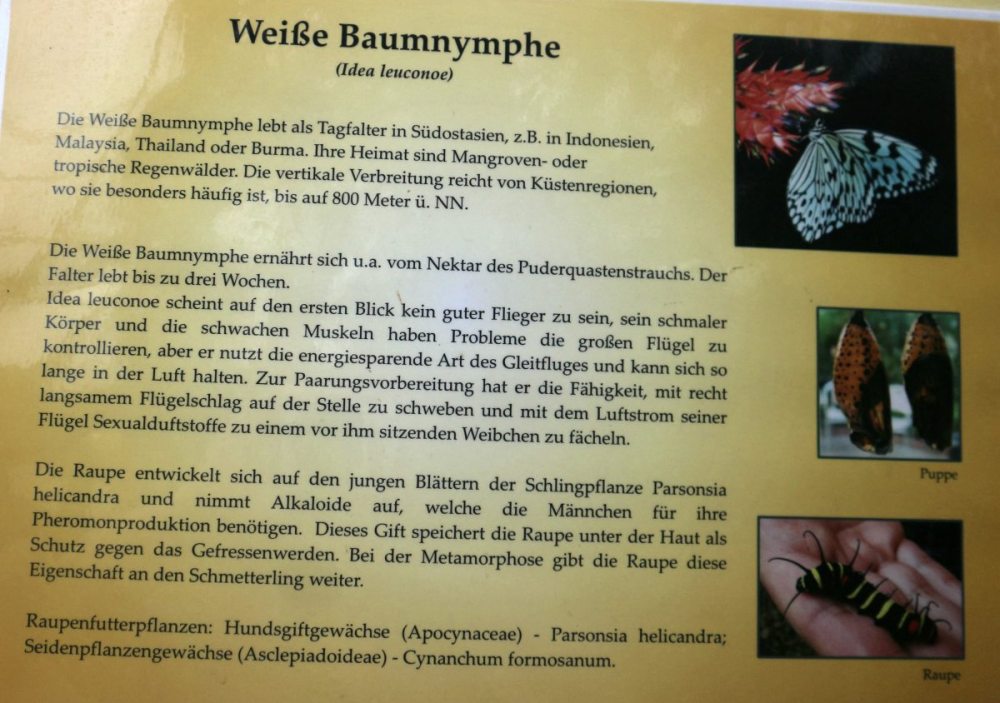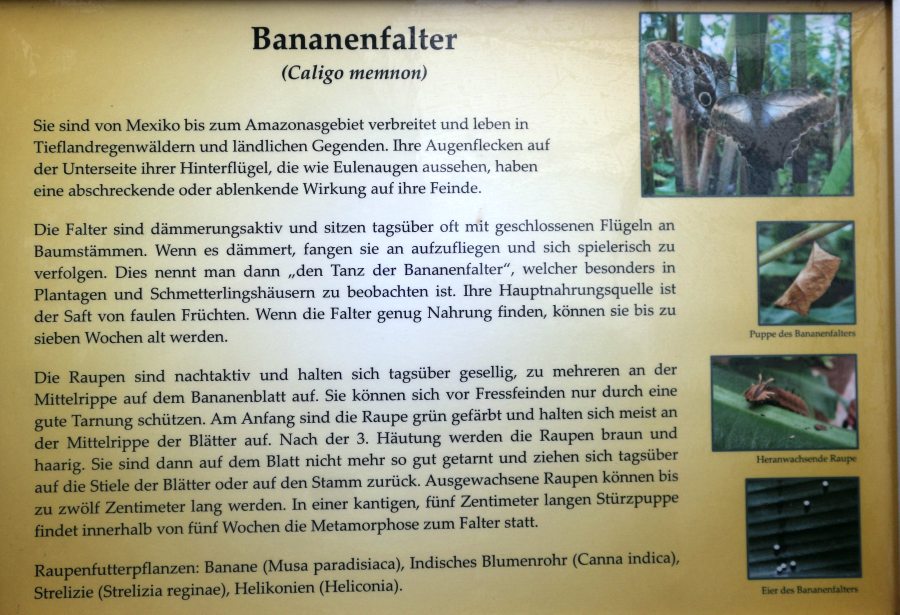Frühlings-Tour
2023 / Sternwarte Bergedorf, Kloster Loccum und Schmetterlinge

Anlässlich eines Vortrags bei der GVA gab es die Gelegenheit
in Hamburg die Sternwarte Bergedorf zu besichtigen.
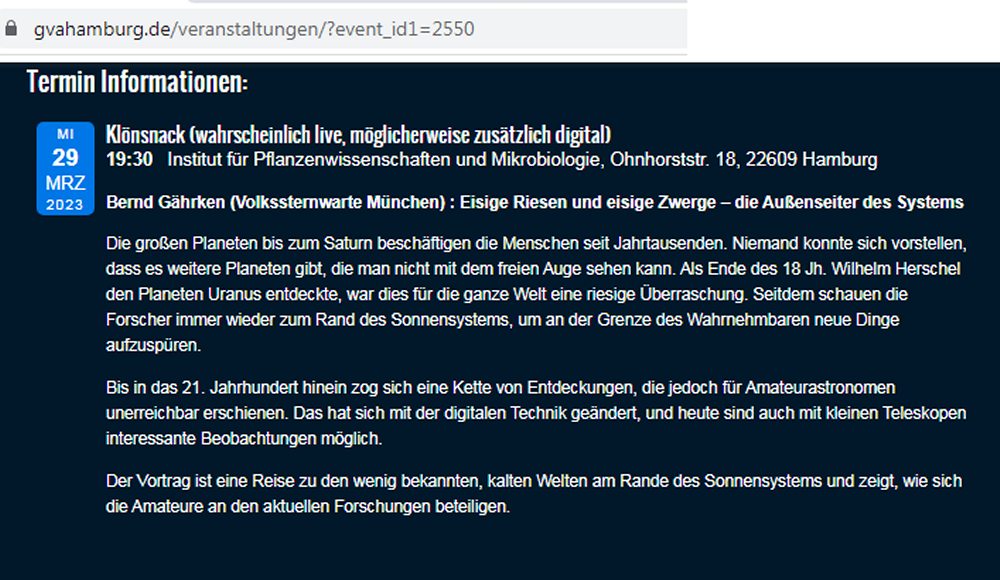




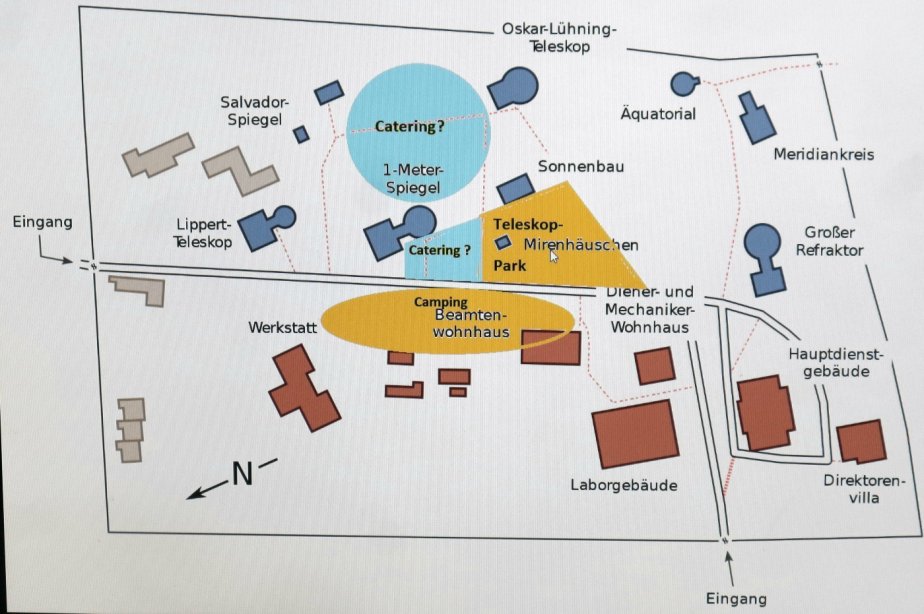
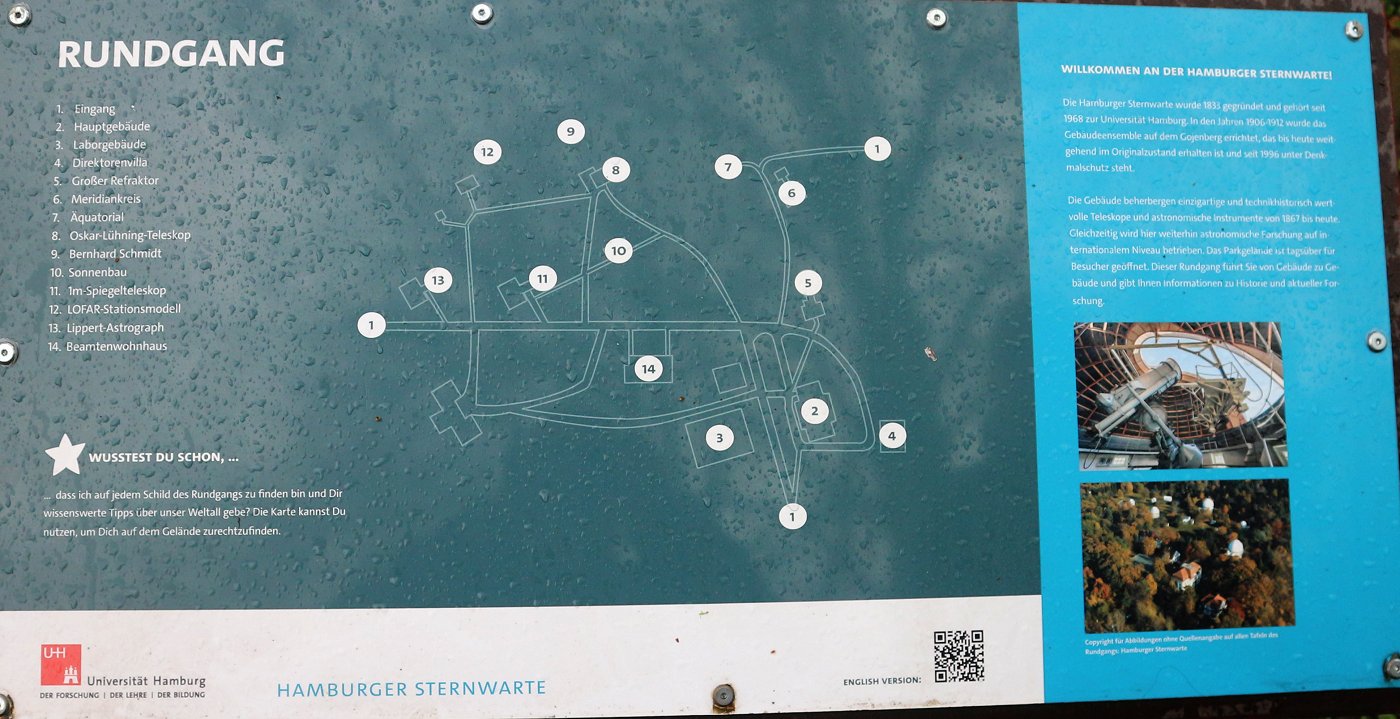
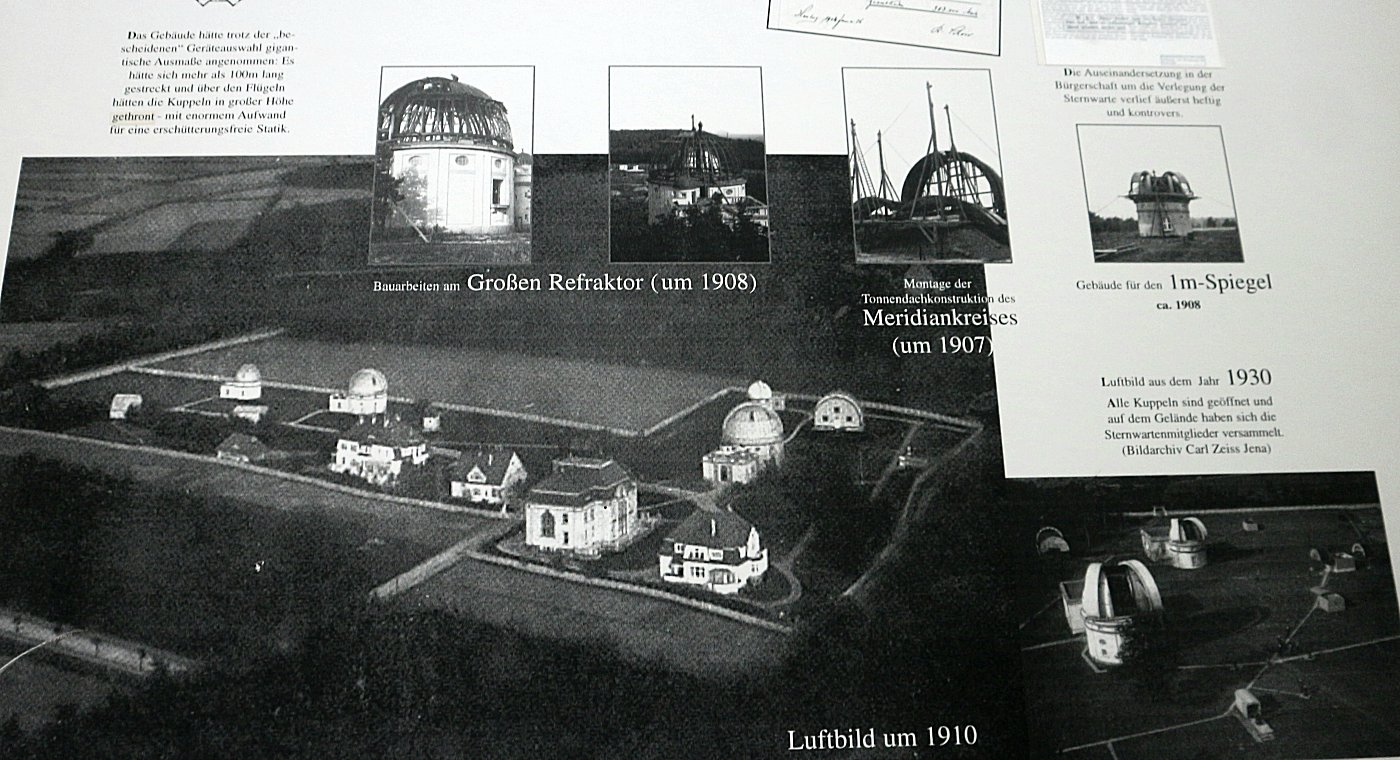
Die Sternwarte wurde 1912 offiziell
eingeweiht.
Ein wichtiges Ziel war die Zeitmessung für den Hamburger Hafen.
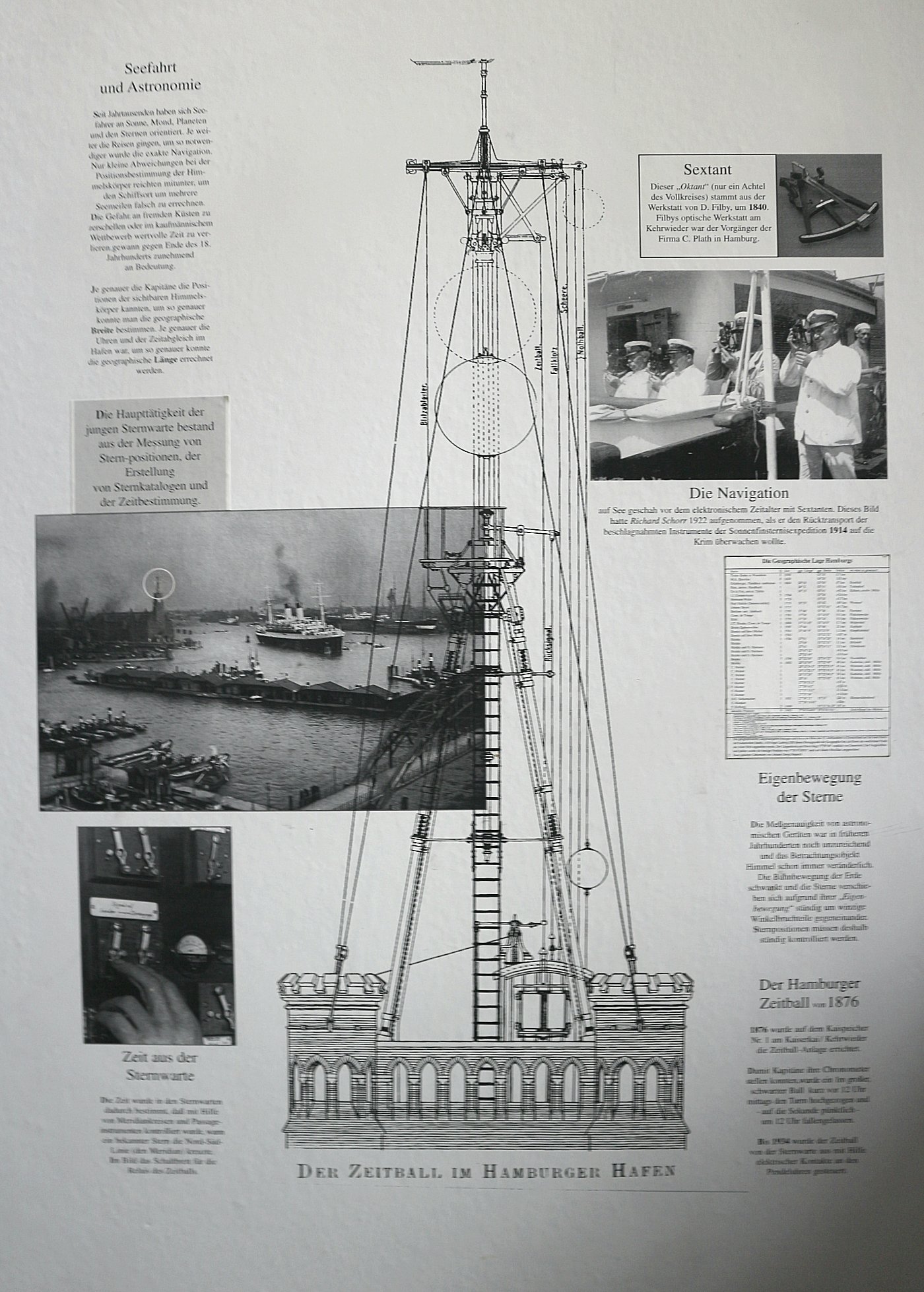
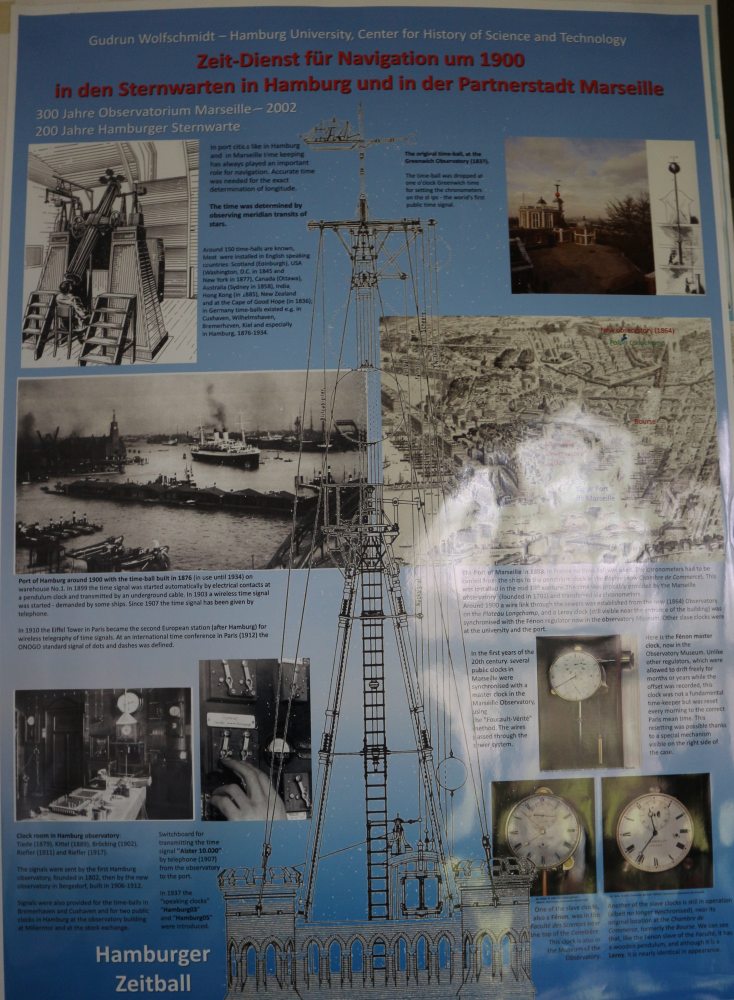

Ausgerüstet war sie anfangs mit einem Meridiankreis, einem
großen Refraktor mit 60 cm Öffnung von
„Repsold & Söhne“, einem
Newton-Teleskop von Carl Zeiss mit einem Hauptspiegel von 1 m
Durchmesser.
Das Teleskop war bei seiner Inbetriebnahme im Jahre 1911 das
viertgrößte der Welt und das
größte Teleskop Deutschlands.



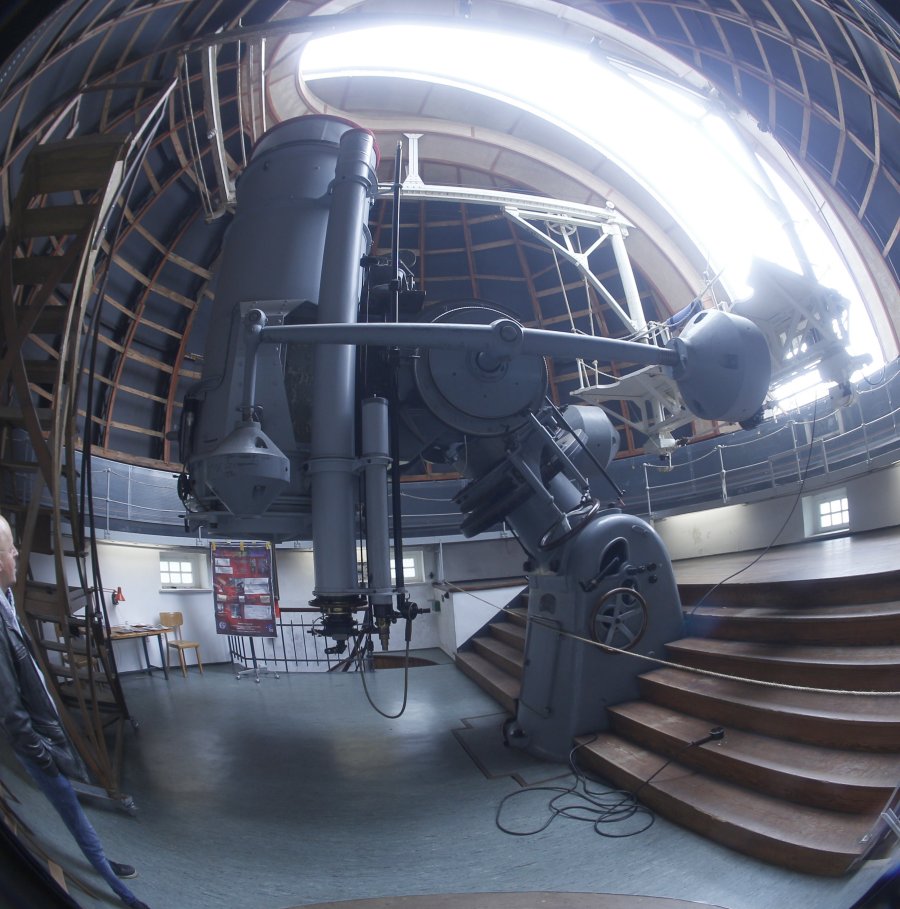
Ab 1926 arbeitete der Optiker und
Teleskopkonstrukteur Bernhard Schmidt
als freier Mitarbeiter an der Sternwarte. Hier gelang Schmidt 1930 die
Herstellung einer asphärischen Korrektionslinse und damit die
Erfindung des „Schmidt-Spiegels“. Die extrem
lichtstarke und bis an den Bildrand der Fotoplatten komafreie
Weitwinkelkamera ist eine der durchgreifenden Neuerungen in der
Astrofotografie des 20. Jahrhunderts.
In der Hütte des ersten Schmidteleskops steht heute ein
anderes Gerät.

1954 wurde der lang geplante große „Hamburger
Schmidt-Spiegel“ in Betrieb genommen. Die freie
Öffnung lag bei 80cm. Mit diesem Gerät entdeckte der
Astronom Luboš Kohoutek 1973 seinen berühmten
Kometen.
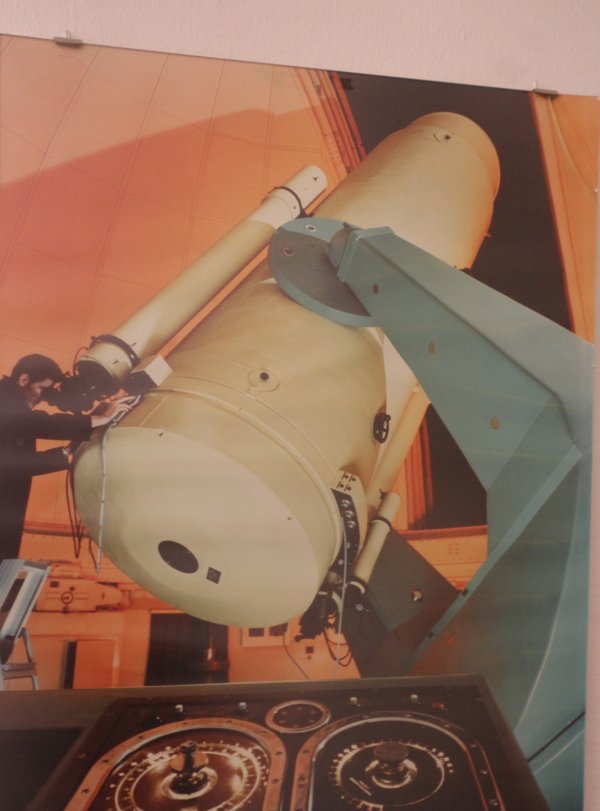

Heute auf dem Calar Alto - aber im Keller noch als Modell:


1976 wurde der große
Schmidtspiegel zum deutsch-spanischen
Calar-Alto-Observatorium in Südspanien verlagert. An seiner
Stelle wurde in Bergedorf ein großes
Ritchey-Chrétien-Cassegrain-Teleskop mit 1,20 m
Öffnung als
„Oskar-Lühning-Teleskop“ in Betrieb
genommen.



Im Kuppelgebäude wurde auch eine
Anlage zur
Aluminium-Bedampfung von Teleskopspiegeln errichtet, in der Spiegel bis
zu einem Durchmesser von 1,5 m beschichtet werden können. Die
Anlage ist bis heute in Betrieb.

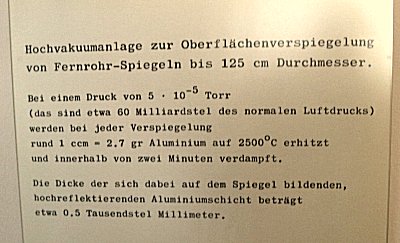
Der große Refraktor hat 60cm Öffnung



Bei der Montierung sind noch Reste des gewichtsantriebes sichtbar.
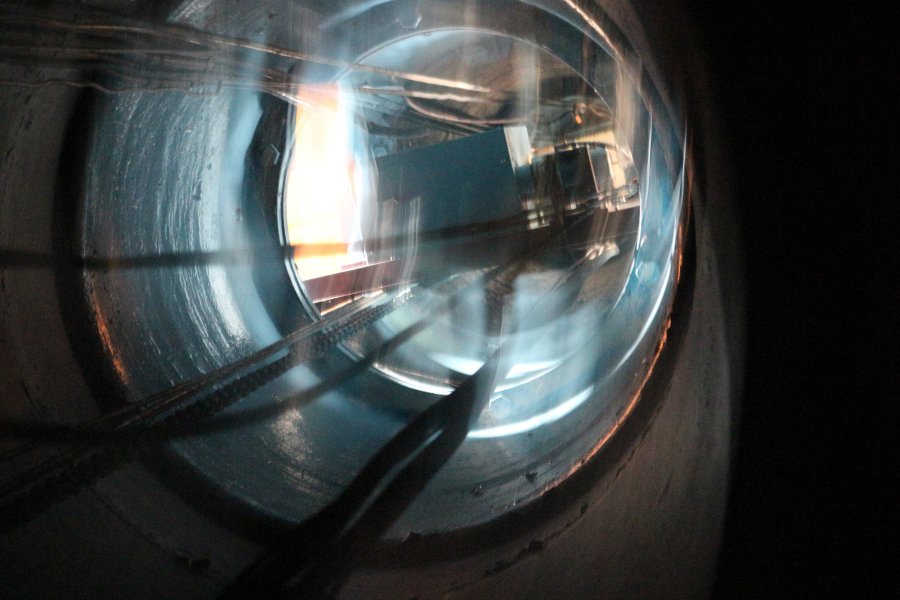

Das Lippert-Teleskop, besteht aus zwei
Refraktoren, die als
Leitfernrohr dienten. Mit dem Teleskop das in einer 7 m große
Beobachtungskuppel steht
wurden von Schwassmann und Wachmann mehrere Kometen entdeckt. u.a. auch
73p-Schwassman-Wachmann-3 der 1995 zerbrach und 2022 zu einer
erhöhten
Fallrate der Tau-Herculiden führte.
Das älteste Instrument der Sternwarte ist sas Aquatorial. Es
stand schon in der Vorgängersternwarte in der Innenstadt.
Bemerkenswert ist schöne originale Beobachterstuhl.



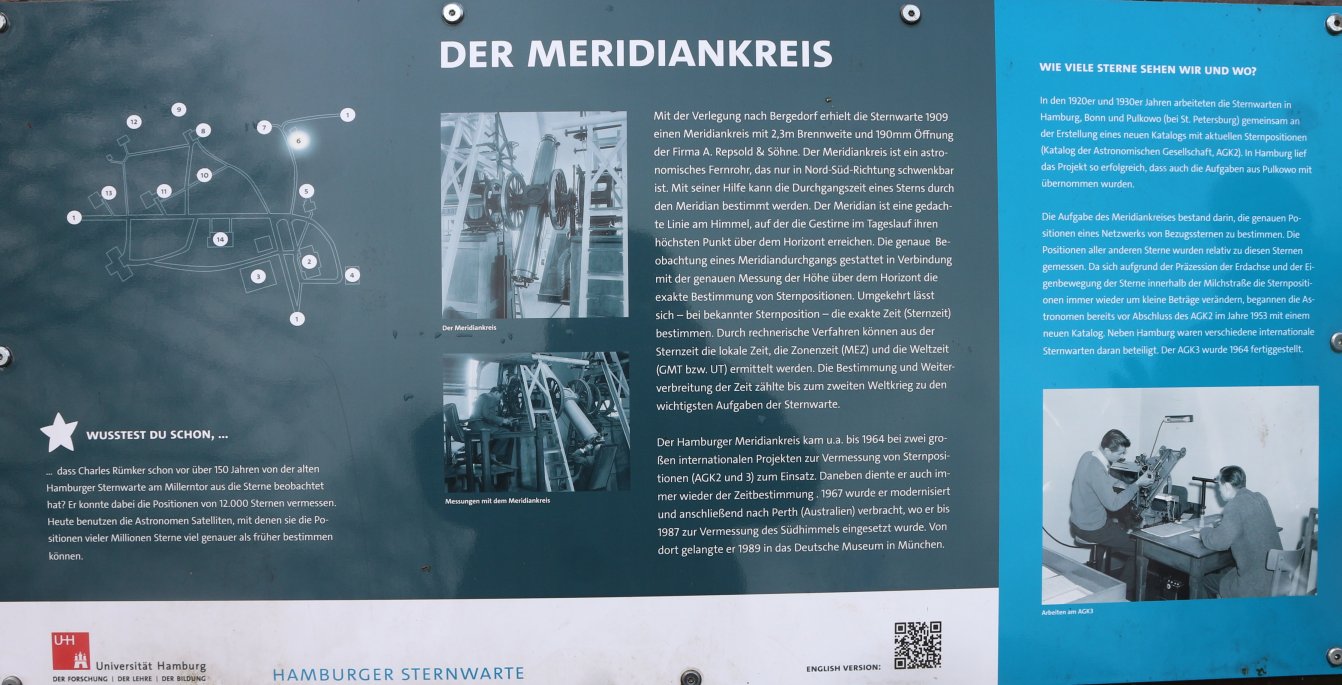

Im Keller des Hauptgebäudes befindet sich das Schmidt-Museum,
in dem Geräte von Bernhard Schmidt ausgestellt werden, unter
anderem der von ihm konstruierte erste Schmidt-Spiegel. Das Museum ist
winzig und besteht nur aus einem kleinen Raum, enthält aber
den ersten Prototyp einer Schmidtplatte die beidseitig geschliffen ist
sowie das erste Schmidt-Teleskop.

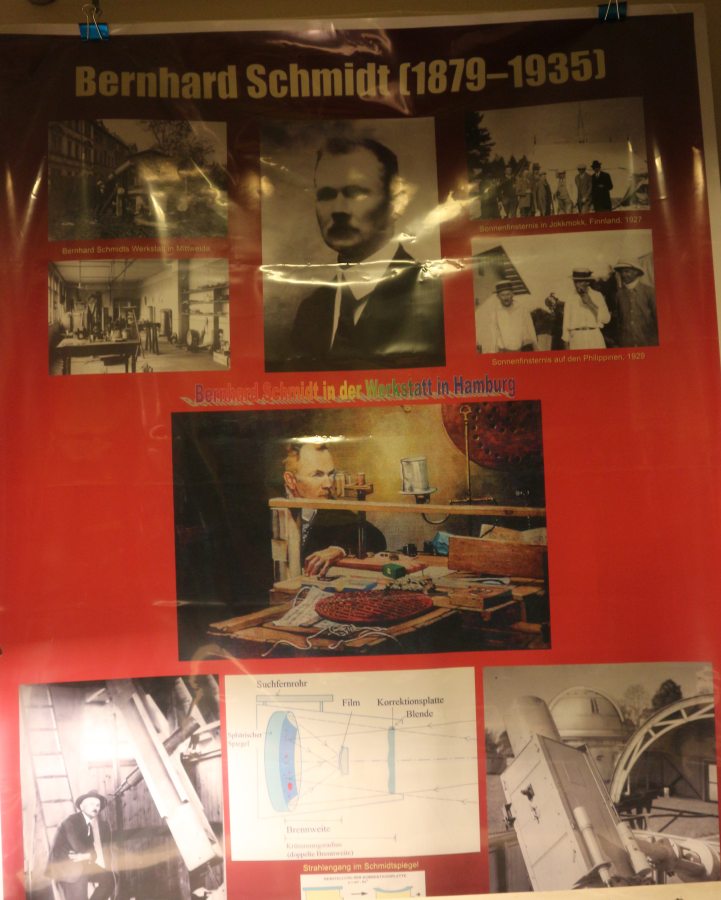

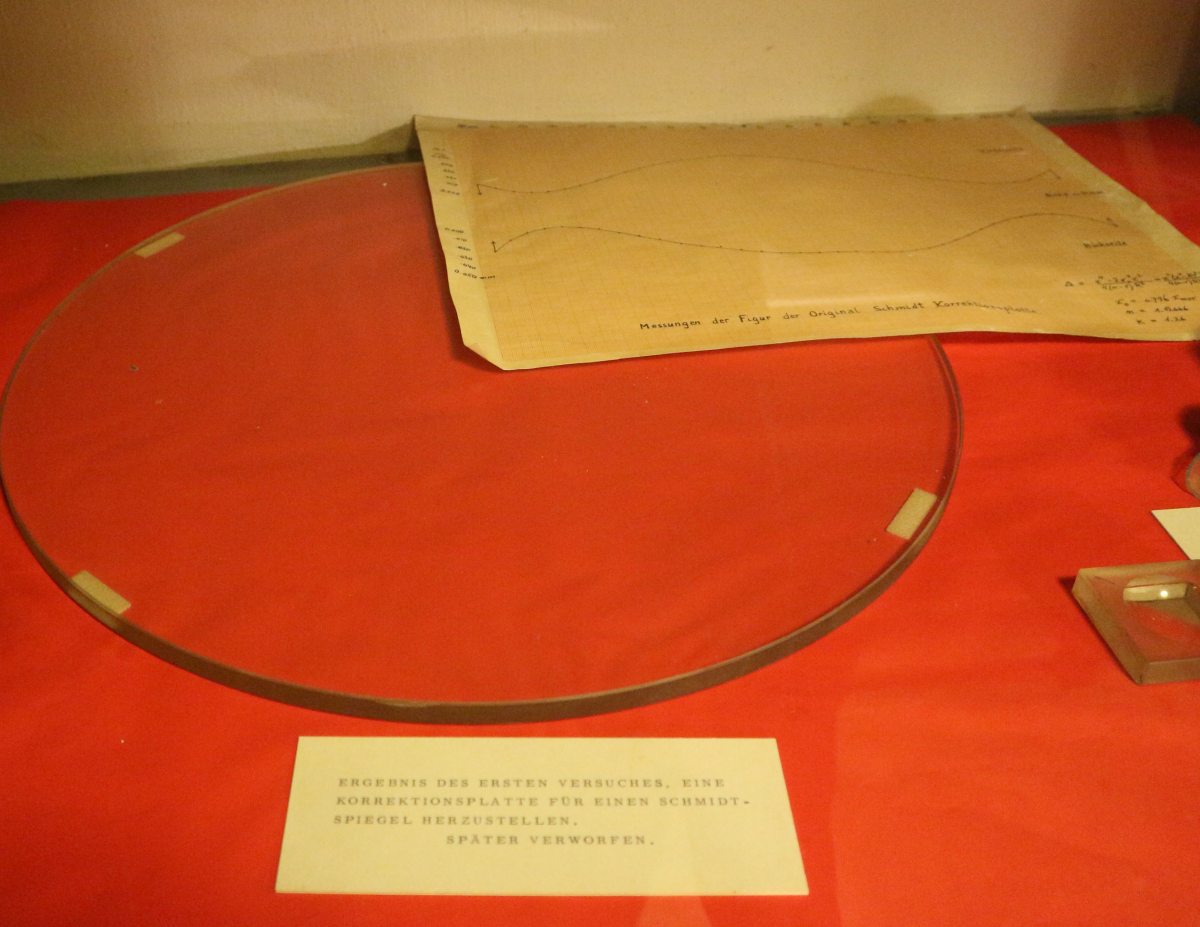
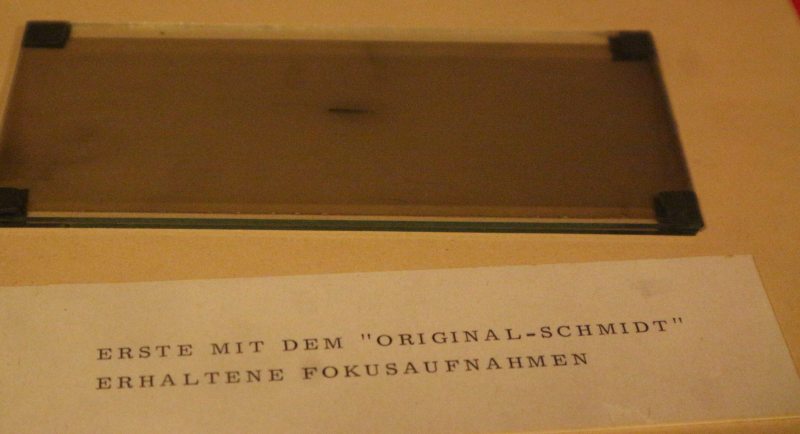
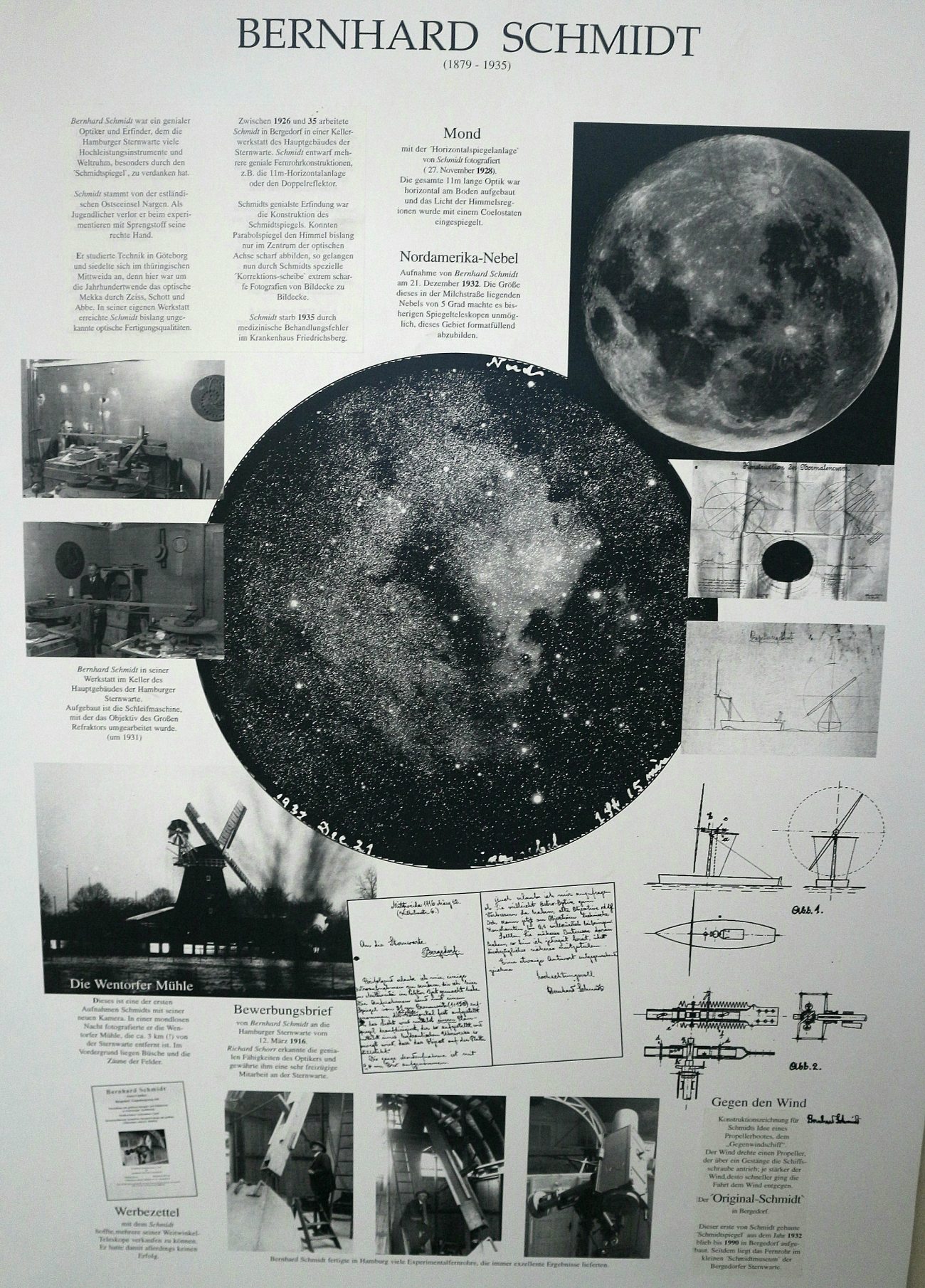
Die über 70.000 Bände
umfassende Bibliothek ist im
Hauptgebäude untergebracht und enthält alle wichtigen
astronomischen Veröffentlichungen der letzten 200 Jahre. Der
repräsentative Raum hat das Format einer Schlossbibliothek.
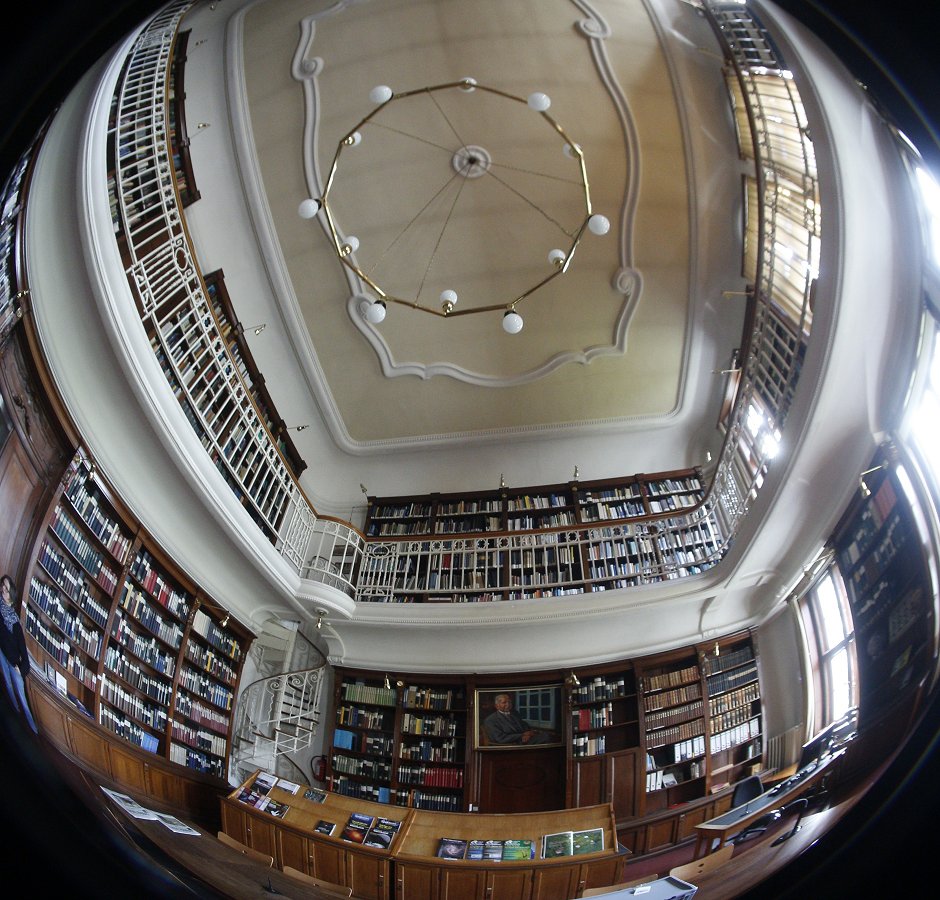

An der Sonnenfinsternisexpedition war
Schmidt beteiligt.
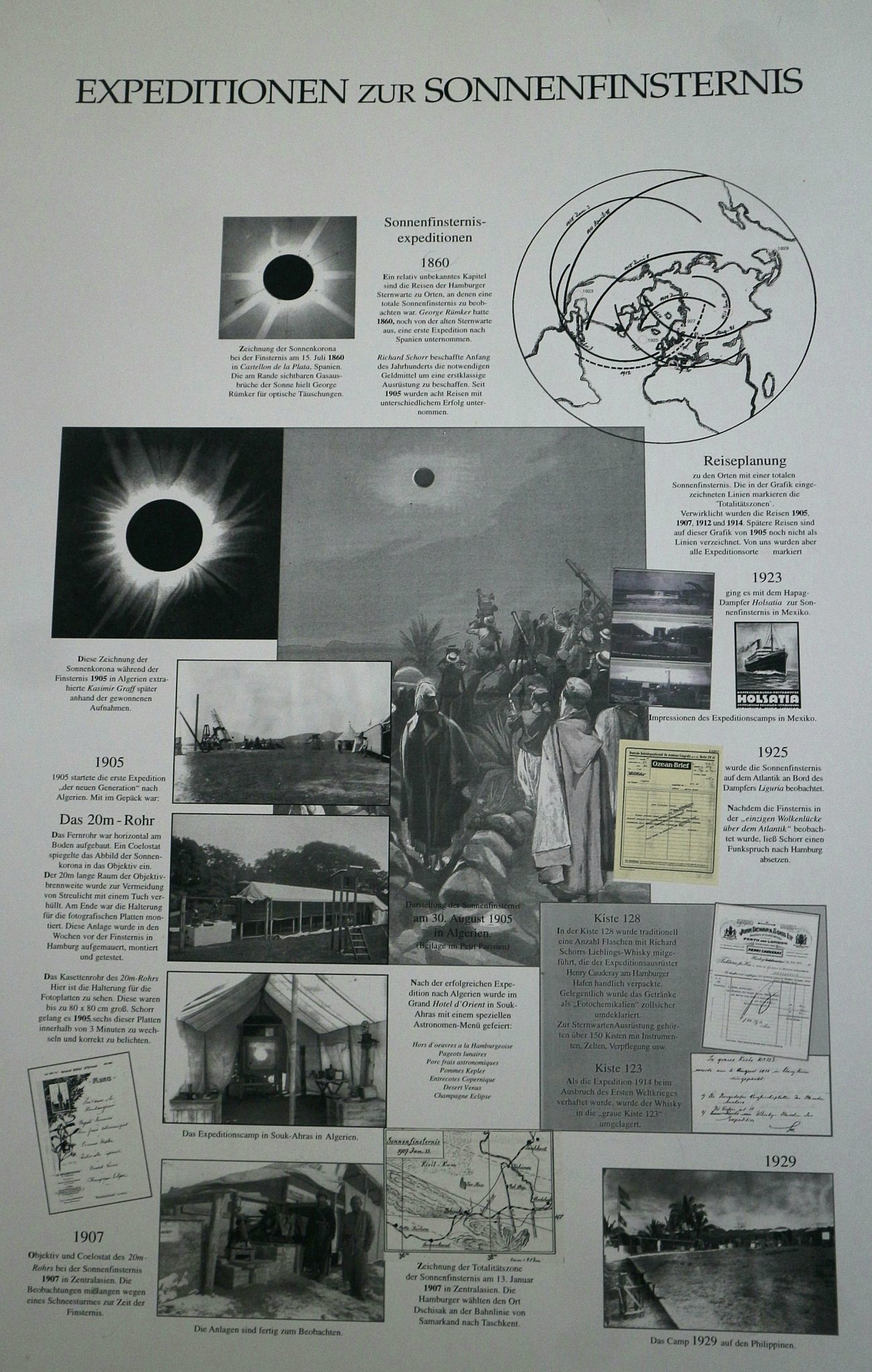
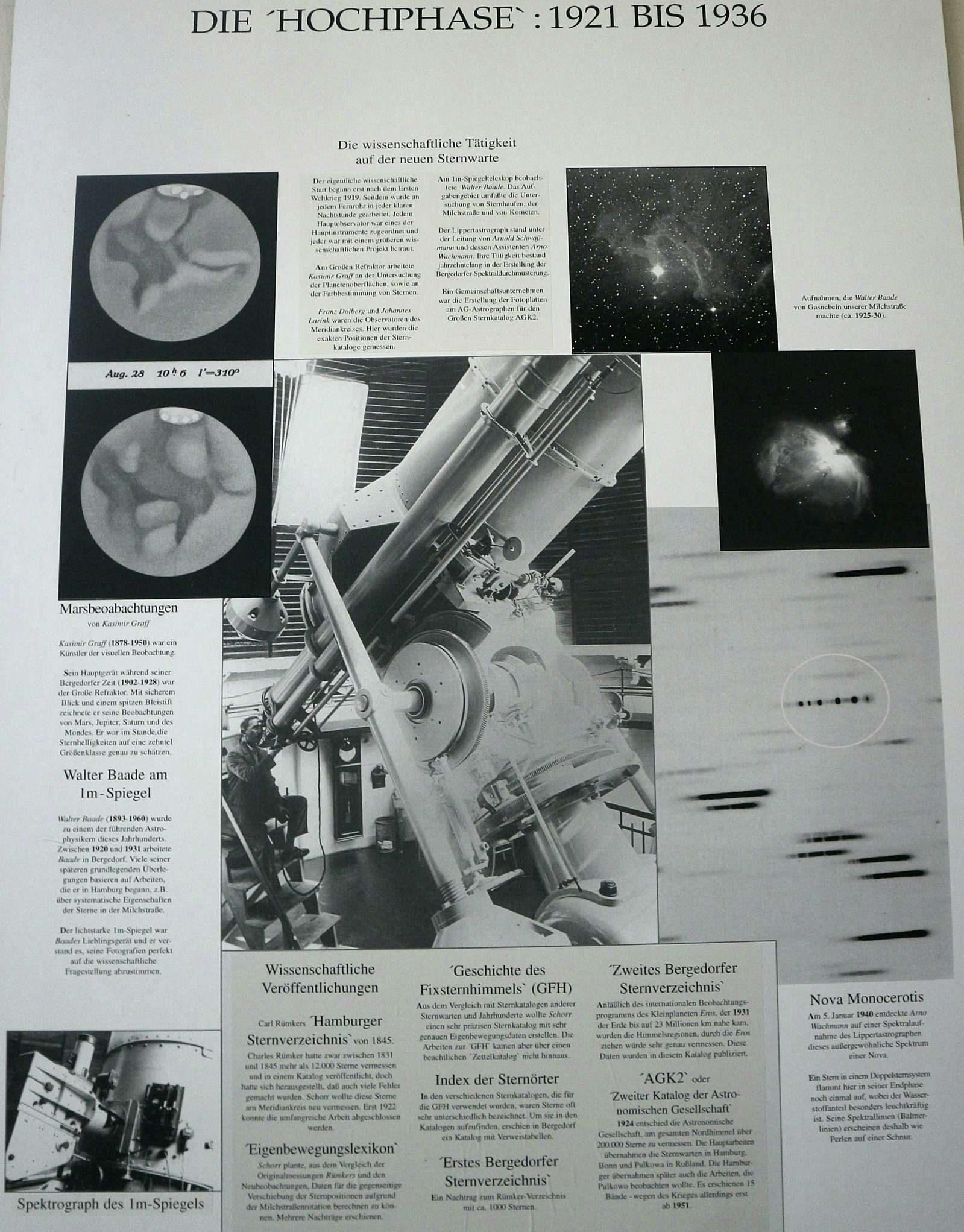
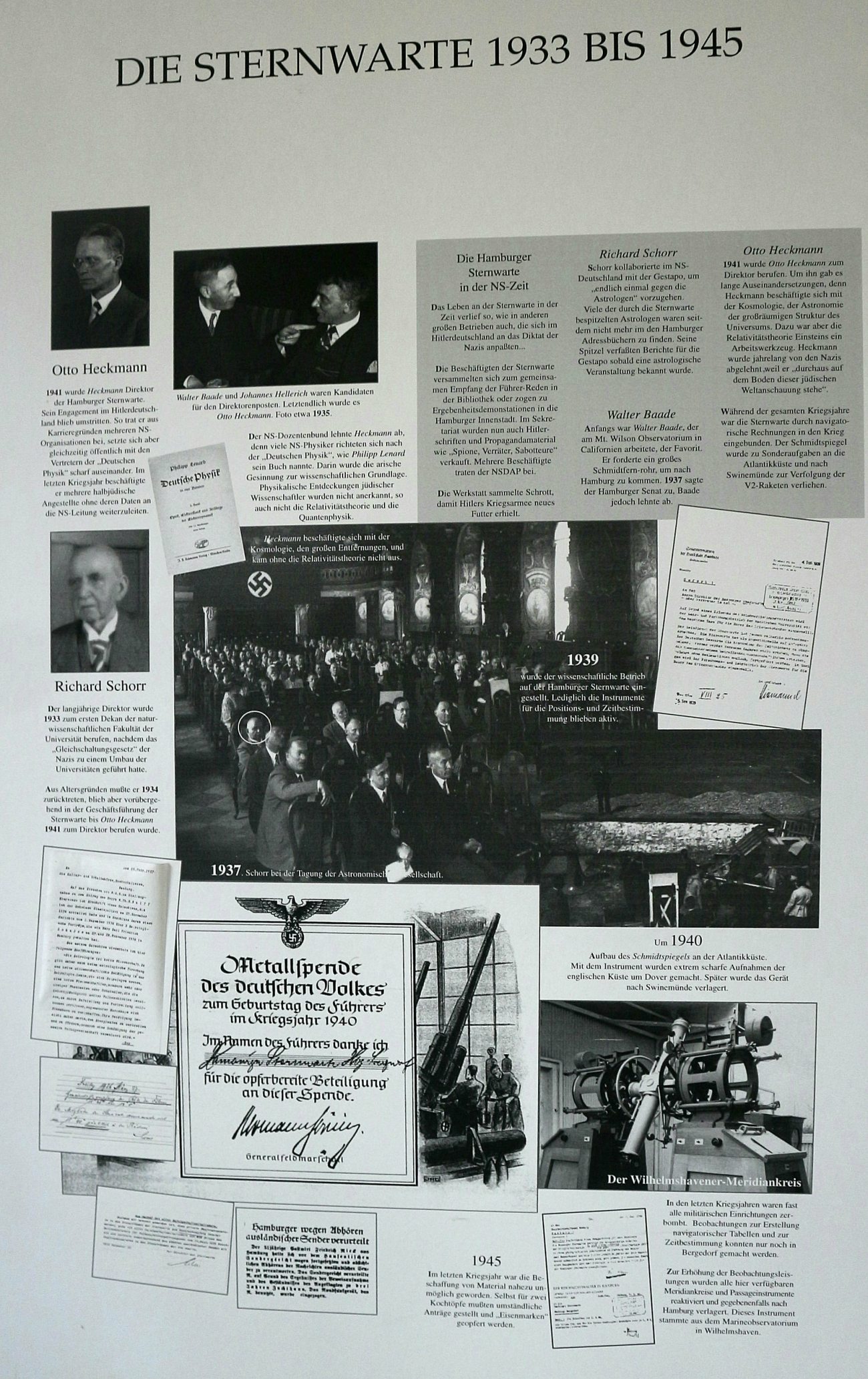
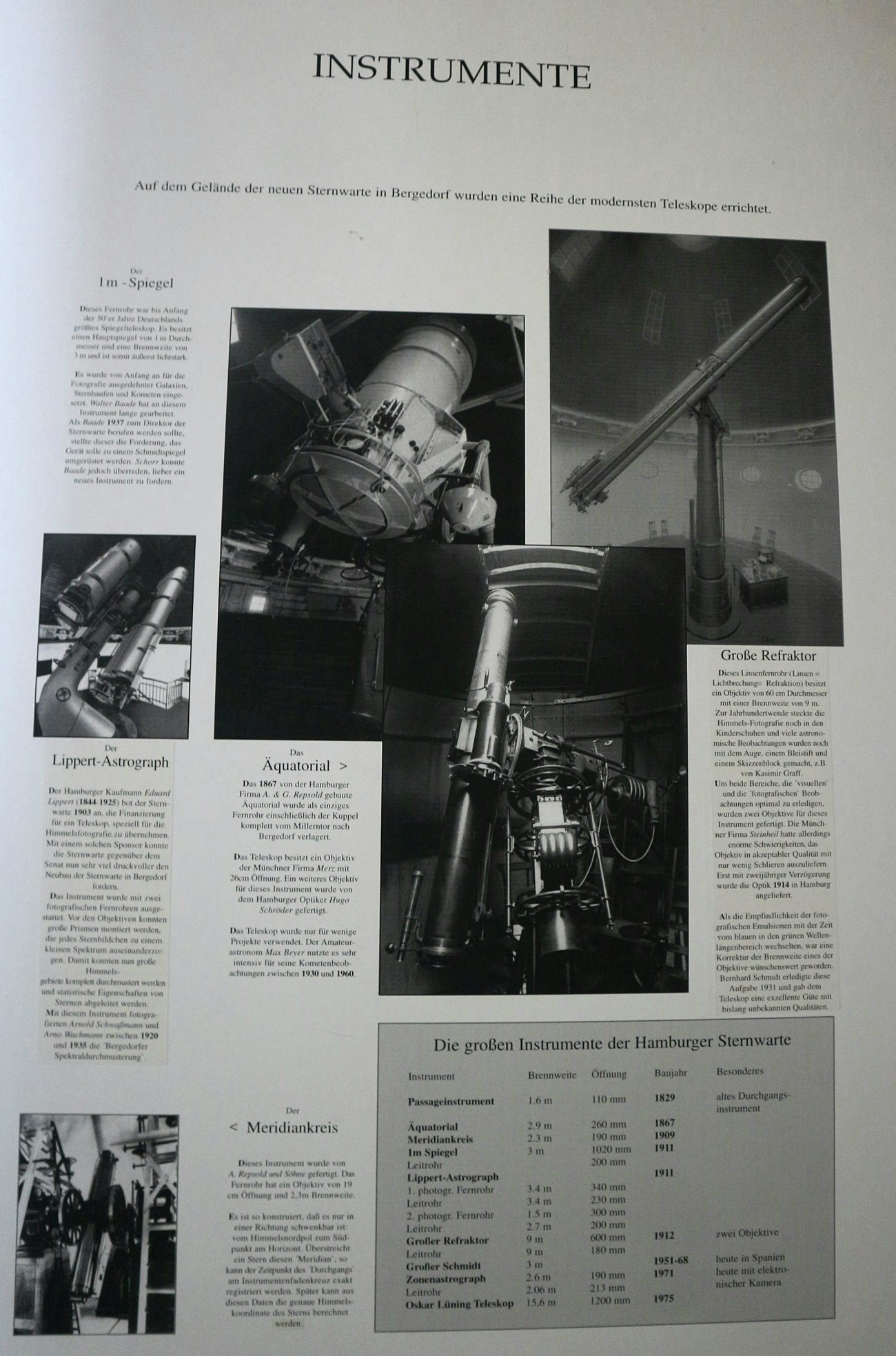
Am Nachmittag
wurde das Kloster Loccum besichtigt.
Die Anlage des 1163 gegründeten Zisterzienser-Klosters
gehört zu den am besten erhaltenen nördlich der
Alpen. Die ältesten Gebäude sind die ehemalige
Stiftskirche, die heutige Georgskirche, der Kreuzgang, das Slaphus und
das Laienrefektorium, die aus dem 13. Jahrhundert stammen. Das
Refektorium wurde 1599 fertiggestellt, das Konventshaus um 1750
errichtet. Seit etwa 1600 besteht in den ehemaligen
Klostergebäuden ein lutherischer Konvent, der auch weiterhin
einen Abt wählt.
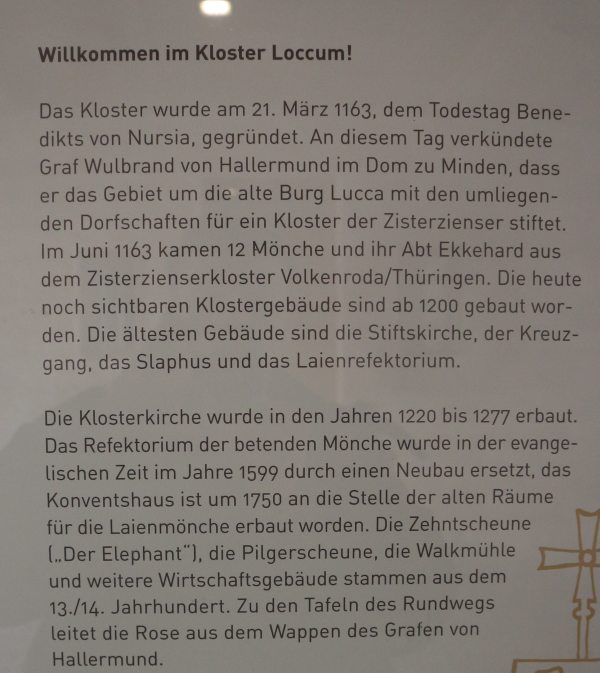
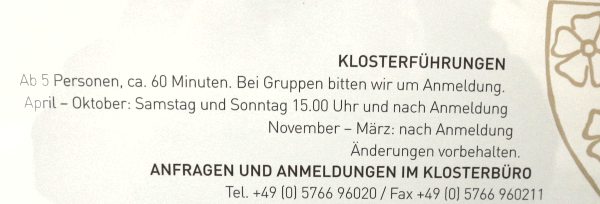
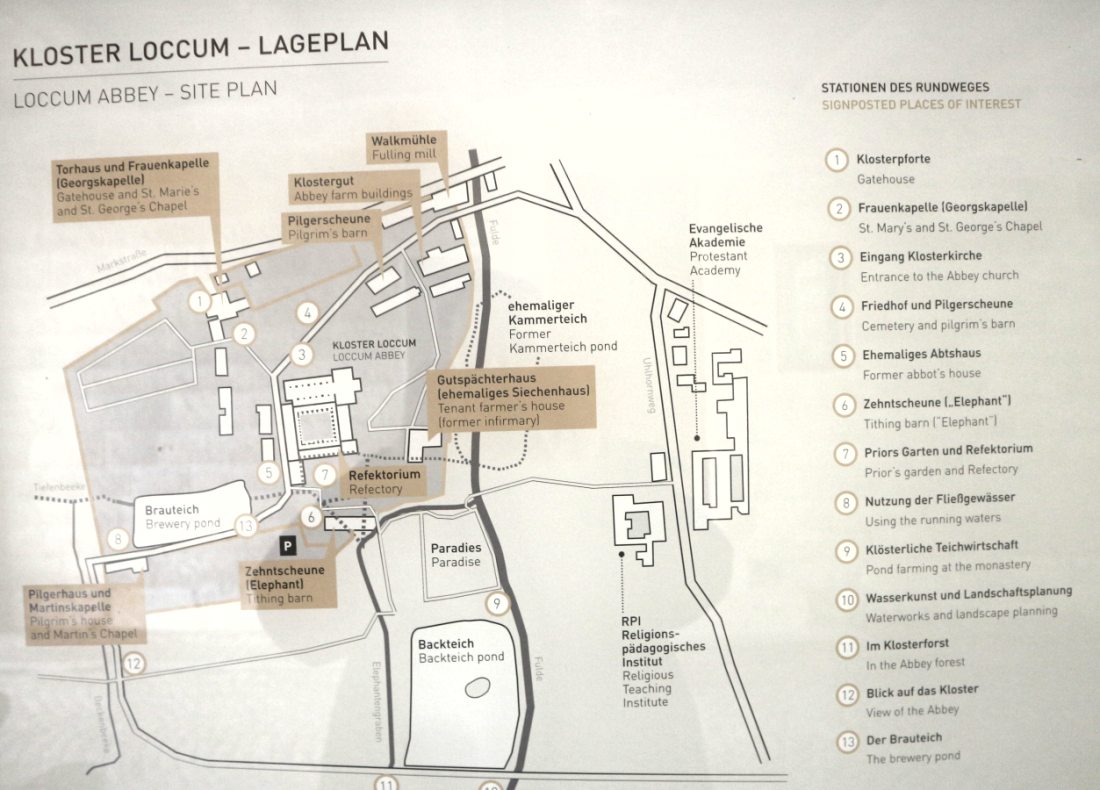



Zahlreiche, oft figürlich
aufwändige
Grabmäler und Epitaphe zeugen von der Beliebtheit der
Klosterkirche als Grablege für Adel und Geistlichkeit.



Ein seltenes Ausstattungsstück noch
aus der Bauzeit der Kirche
um die Mitte des 13. Jahrhunderts ist der hölzerne
Reliquienaltar. Die Fassung stammt allerdings vollständig aus
der Mitte des 19. Jahrhunderts.

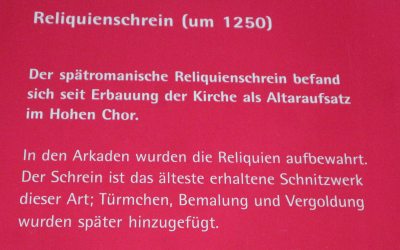
Den heutigen Hochaltar schmückt ein
Retabel mit Figuren aus
der Werkstatt des Meisters von Osnabrück, um 1520. Seine
gemalten Flügel, auf der Innenseite mit Passionsszenen,
außen mit Darstellungen Christi im Limbus und der
Auferstehung versehen, wurden im 17. Jahrhundert angefügt. Aus
dem späten Mittelalter stammt auch das Sakramentshaus. Auf der
Spitze
ist ein Pelikan zu sehen der sich die Brust aufreist um mit seinem Blut
seine Kinder zu füttern. Im Mittelalter sah man in dieser
Geschichte ein Gleichnis zu Christus.
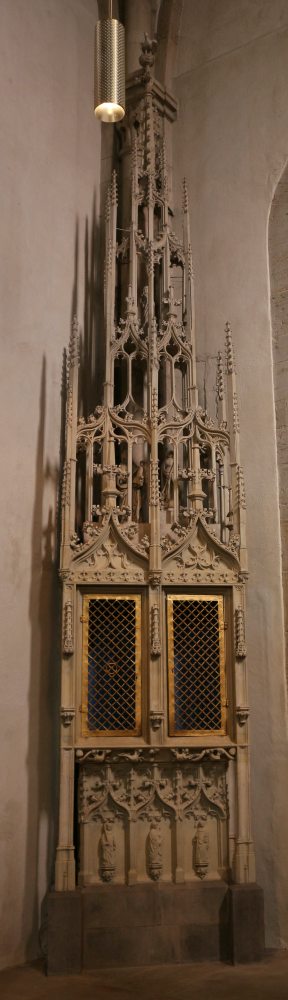
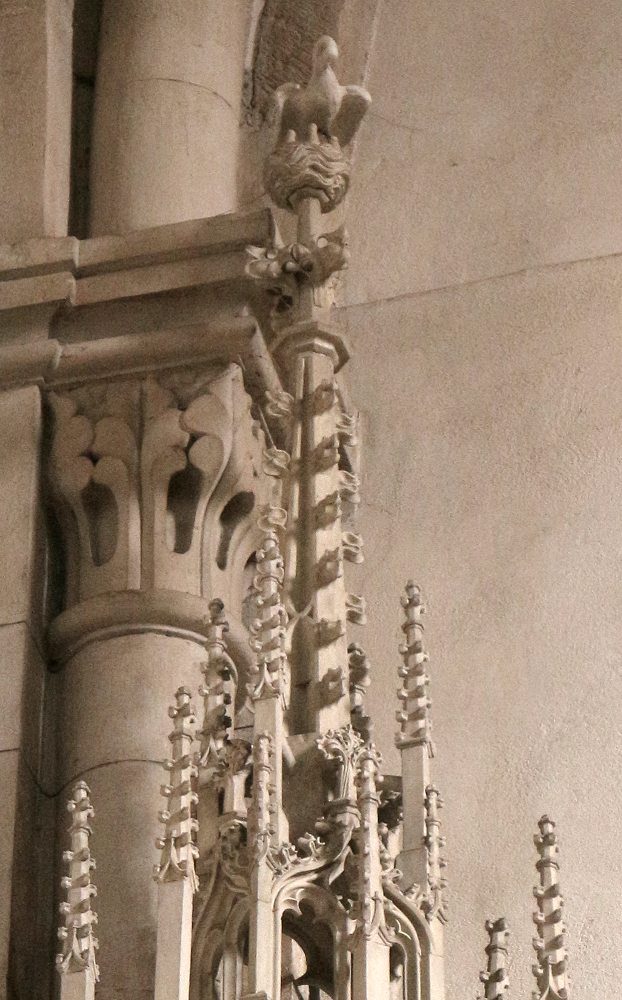


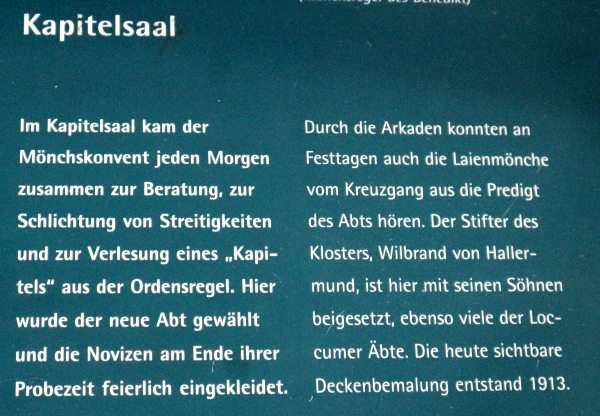

Das Kloster ist nur
wenige Kilometer vom Steinhuder Meer
entfernt.
Leider war es bei der Ankunft schon zu spät für eine
Bootstour.

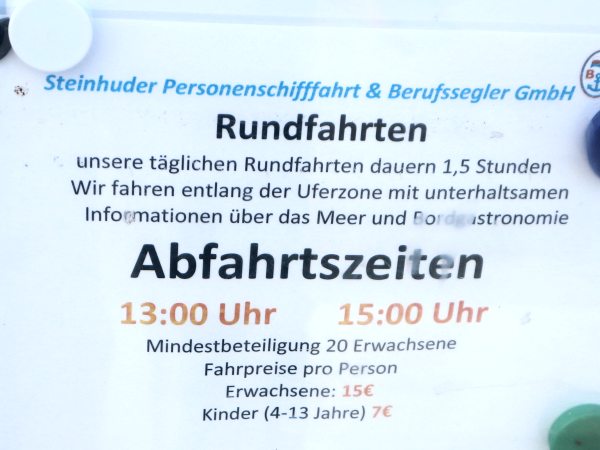

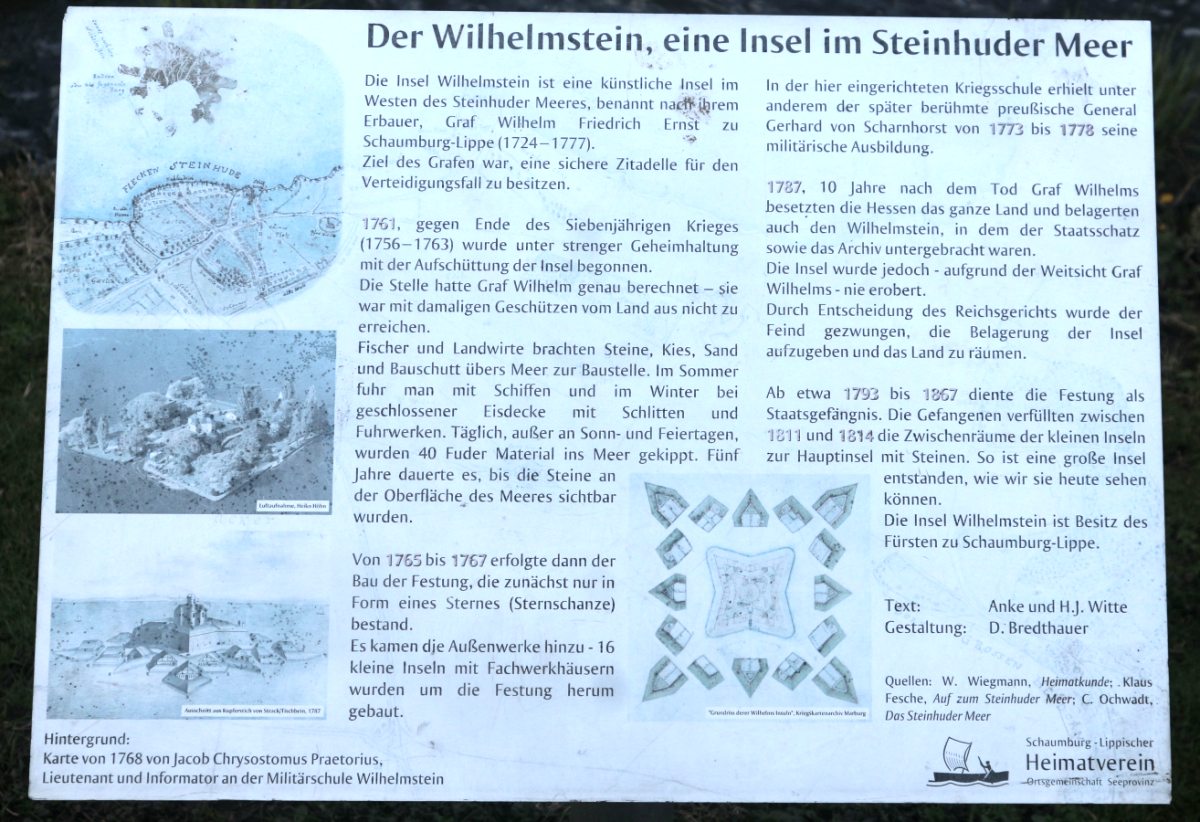
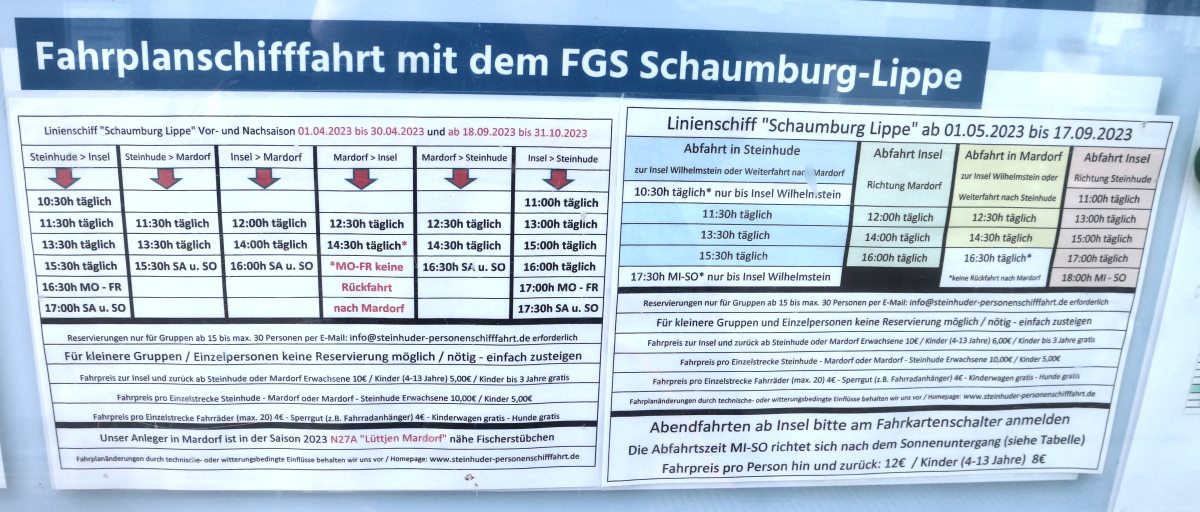
Als Alternative wurde ein Schmetterlingshaus besichtigt.
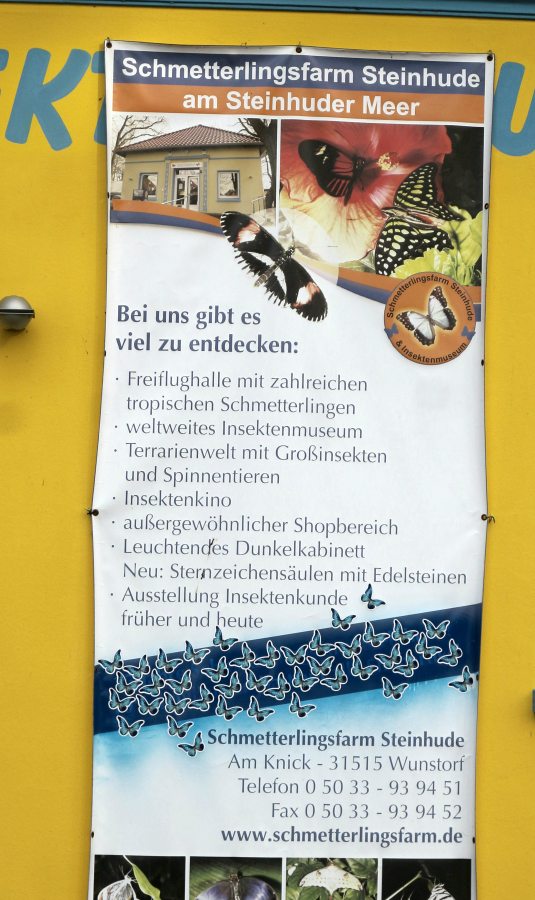

Die Ausstellung zeigt zahlreiche
Präparate von riesigen
Käfern und Schmetterlingen aus Ozeanien und Australien.




Ein kleiner Trilobit zeigt die Verwandschaft zu den heutigen
Gliedertieren wie den Skorpionen.
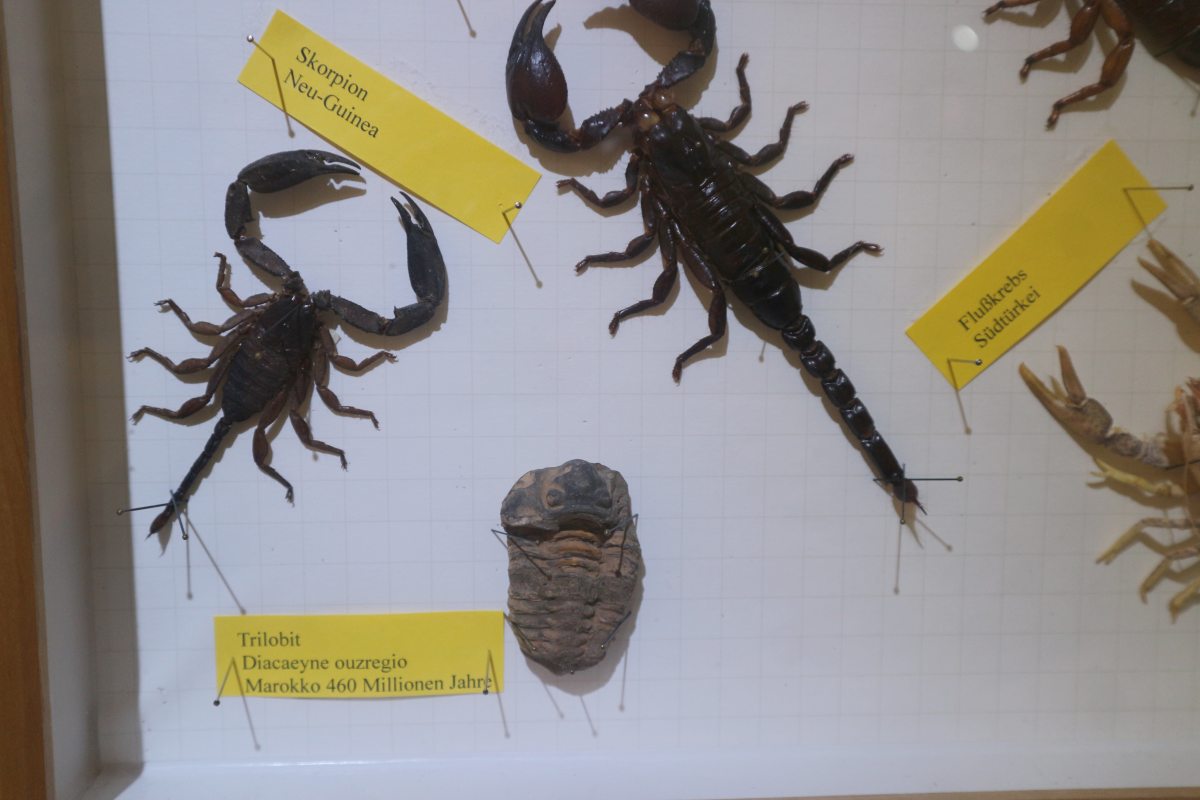
Auch lebende Vogelspinnen waren in der Ausstellung


Die Schmetterlinge im Treibhaus werden
als Puppen gekauft und
schlüpfen vor Ort. Etwa ein halbes Dutzend Arten flog herum
und konnte bestimmt werden.